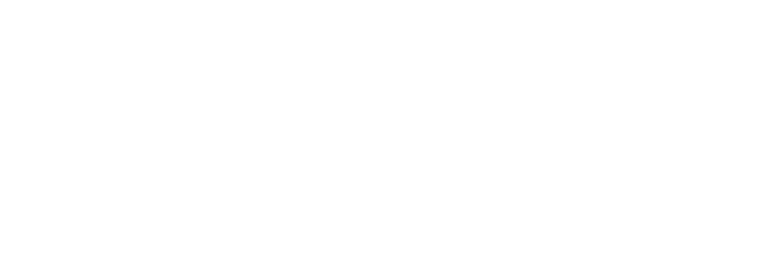Alte Geschichte als historische Sozialwissenschaft

Das Jacobi-Stipendium der Kommission für Alte Geschichte und Epigraphik für Doktorandinnen und Doktoranden feiert 2025 sein 20-jähriges Bestehen. Im Jubiläumsjahr stellen wir in monatlicher Folge zwölf ehemalige Jacobi-Stipendiatinnen und -Stipendiaten vor, die aus ihrer derzeitigen Arbeit berichten. Wir haben ihnen fünf Fragen gestellt, die sie schriftlich beantwortet haben. Im März lernen wir Prof. Christoph Lundgreen kennen. Er ist Professor für Alte Geschichte an der Technischen Universität Dresden. Prof. Lundgreen war im Jahr 2009 mit dem Projekt Lex, ius, mos – aber keine Verfassung? Normenhierarchie und Metaregeln in der römischen Republik Jacobi-Stipendiat in München.
„Dieser doppelte Blick, von uns auf die Antike, aber auch wieder auf uns zurück, den ich so faszinierend finde“
Prof. Schuler: Wie ist es dazu gekommen, dass Sie eine akademische Laufbahn in den Altertumswissenschaften eingeschlagen haben? Was fasziniert Sie besonders an der Antike?
Prof. Ludgreen: Kohäsion und Konflikt der römischen Senatselite, die Gracchen, das Triumvirat; dazu die Entdeckung des Politischen bei den Griechen, der Prinzipat des Augustus und, vor allem und immer wieder, die Epen Homers – keine Epoche hat auch nur im Ansatz Vergleichbares. Fasziniert hat mich die Antike dabei schon seit der Kindheit, vermittelt durch Gustav Schwabs Sagen des klassischen Altertums ebenso wie durch Asterix. Deswegen wollte ich auch auf ein humanistisches Gymnasium, um Latein und Griechisch zu lernen. Fast noch wichtiger war ein Brettspiel, das ich zusammen mit einem Freund entwickelt habe. Da musste man Gebäude der Stadt Rom einzeichnen und dann, je nach Ereigniskarte, vor Überflutungen des Tibers oder Feuer schützen. Trotz solch eigentlich optimaler Voraussetzungen gab es dann nach dem Abitur die überraschende Entscheidung, Jura zu studieren. Aber mein Auslandsjahr in London hat mich ‘auf den rechten Weg’ zurückgeführt, genauer die Begegnung mit Michael Crawford, dessen Bedingungen für die Teilnahme an seinem Seminar „Fall of the Roman Republic“ mehr oder weniger die völlige Konzentration auf Alte Geschichte bedeuteten, mit Epigraphik, Numismatik und allem, was dazu gehört. Zurück in Berlin folgte ein Abschluss bei Wilfried Nippel, und dann hatte ich das Glück, im deutsch-französischen Graduiertenkolleg bei Martin Jehne und Jean-Louis Ferrary promoviert werden zu können. Das Thema, „Regelkonflikte in Rom“, weist durchaus Spuren der ersten Studienrichtung auf, und geblieben ist bis heute mein großes Interesse an Normen und Devianz. Ausgeweitet auf Fragen der politischen Kultur gilt dies auch etwa für meinen Artikel zu Lucullus, den ich ansonsten schon fast als klassisch althistorisch bezeichnen würde. Für alle Arbeiten zentral ist meine Auffassung von Alter Geschichte als historischer Sozialwissenschaft, die besonders fruchtbar mit theoriegeleiteten Fragestellungen betrieben werden kann. Dies erhöht aus meiner Sicht die Chance, dass Ergebnisse auch für die Gegenwart Relevanz haben. Ich denke beispielsweise an die Analyse ciceronischer Rhetorik, die auf allgemeine Strukturen der Vereinzelung und Ausgrenzung verweist, oder die Distinktion durch Essen und Trinken, die epochenübergreifend funktioniert. Es ist dieser doppelte Blick, von uns auf die Antike und dann aber auch wieder auf uns zurück, den ich so faszinierend finde – ganz abgesehen vom Material selbst, ob es griechische Tragödien oder die Mosaike in Ravenna sind. Sich damit in seiner Arbeitszeit beschäftigen zu dürfen, ist ein großes Privileg.
Die Fortsetzung des Interviews finden Sie hier: https://lisa.gerda-henkel-stiftung.de/20_jahre_jacobi_stipendium_interviewreihe_lundgreen?newsletter=1