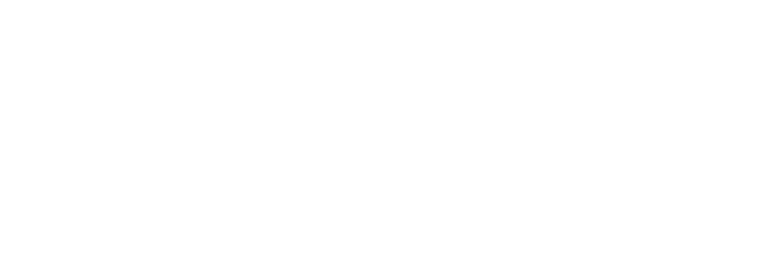Ergebnisse
Die Forschungen der Jahre 2012 und 2013
Während der ersten Feldkampagnen 2012 und 2013 konnten die im Vorjahr entdeckten Areale lithischer Produktionsstätten archäologisch näher untersucht werden. Insgesamt handelt es sich um zwei Schlagplatzreviere, die etwa 700 Meter voneinander entfernt liegen. Ein Fundplatz befindet sich abseits des Weilers Maniaha im höher gelegenen und schwer zugänglichen Bergland und zeichnet sich durch eine enorme Anhäufung lithischer Grundproduktion aus, welche eine erschöpfende Aktivität über einen länger dauernden Zeitraum vermuten lässt.
Die archäologischen Arbeiten konzentrierten sich auf die näher gelegenen und somit logistisch einfacher zu bewältigenden Schlagplätze der zweiten Fundstelle in direkter Nachbarschaft der Ansiedlung.
Der ausgewählte Fundplatz ‚Apunirereha’ umschreibt ein etwa 1000 m² großes Gebiet mit außerordentlich umfangreichem Materialaufkommen an herbeigeschafften Rohmaterialknollen und geschlagenen Steingerätschaften. Der Platz wurde archäologisch gegraben mit dem Ziel, die Akkumulation an steinzeitlichen Hinterlassenschaften in ihrem Umfang zu erfassen, mögliche Verteilungsmuster zu erkennen sowie die stratigraphische Situation zu klären. Gleichzeitig sollte datierbares Material zur Altersbestimmung gewonnen werden. Aus der Grabung sowie deren unmittelbarem Umfeld wurden neben den zahlreichen abgelegten und teils unbearbeiteten Rohmaterialknollen insgesamt 30 Kern- und Scheibenbeile, diverse Halbfabrikate, mehrere Dutzend Schaber und Kratzer sowie Kerne unterschiedlicher Machart geborgen. Die vielfältigen Varianten im Werkzeugbestand ermöglichen jetzt die Entwicklung und Aufstellung eines Typologiegerüstes für die Einreihung entsprechender Artefakte von den Salomonen Inseln.
Aus verschiedenen Schichtkontexten und aus Feuer- und Kochstellen (‚Umu‘) wurden Holzkohleproben isoliert, die für eine Radiokarbondatierung bestimmt waren. Eine erste 14C Datierungsserie markiert den zeitlichen Rahmen dieses Schlagplatzes zwischen 2050 BP und 500 BP. Die gefertigten lithischen Produkte wurden anzunehmend als Handels- oder Tauschware regional und überregional in Umlauf gebracht.
Der Fundort ‚Apunirereha’ nimmt dabei eine wichtige geographische sowie historische Schlüsselposition für den Salomonen-Archipel ein. Inter-insulare Kontakte, auch über größere Distanzen, und funktionierende Beziehungsgeflechte haben im melanesischen Raum eine lange und notwendige Tradition.
Als weiterer Fundplatz wurde das ‚Ria’ Felsschutzdach archäologisch sondiert. Anthropogen bedingte Sedimenteinlagerungen sowie darin enthaltene Kulturschichten mit deutlichen Befundstrukturen und umfangreiches Fundmaterial weisen den Platz als vom Menschen stark frequentierte Stätte aus.
So konnten aus den oberen Schichten verschiedene Steingeräte, Mikrofauna, sowie Schalen von Gastropoden und Bivalven geborgen werden. In der Nähe der Felswand gefundene Menschenreste deuten auf eine Bestattung hin. Das Skelettmaterial eröffnet die Möglichkeit, anthropologische und genetische Untersuchungen vorzunehmen.
Im Forschungsprogramm verankert sind Gebrauchsspurenuntersuchungen an den Steingeräten sowie die petrologische Charakterisierung des Rohmaterials und Werkstoffes „Feuerstein“‚Silex’ und dazugehörige Provenienzanalysen.
Kooperierende Institutionen und Partner: Solomon Islands National Museum (Director Tony Heorake, Chief archaeologist Lawrence Kiko), Ministry of Culture and Tourism Solomon Islands (Director of Culture John Tahinao).
Logistische Hilfestellung: Deutsche Botschaft Canberra (Australien), Honorarkonsulat der Bundesrepublik Deutschland auf den Salomonen (Honorarkonsul Gerald Stenzel).
Beiträge zum Projekt in den DAI e-Forschungsberichten
eDAI FB 2-2018
eDAI FB 1-2014
Downloads
eFB14-1 Moser_Malaita.pdf (pdf) MALAITA, SALOMONEN INSELN Besiedlungsgeschichte Melanesiens – Vorgeschichte der Salomonen Inseln