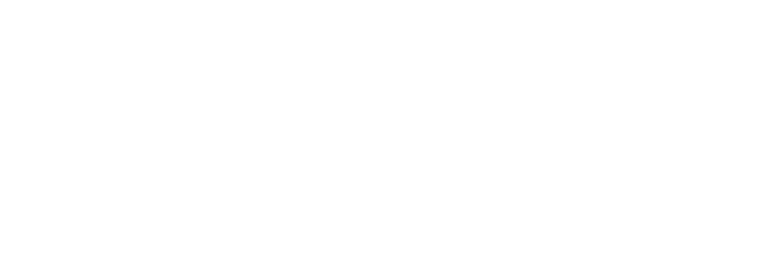Forschung
Befestigungsforschung und Symboltheorie
Nach längeren Zeiten der eher geringen Beachtung hat in den letzten Jahren die Beschäftigung mit antiken Befestigungen einen großen Aufschwung erlebt, was nicht zuletzt den verbesserten technischen Untersuchungs- und Dokumentationsmethoden zuzuschreiben ist, die bei den meist ausgedehnten Anlagen eine Grundvoraussetzung integraler Bearbeitung sind. Dies schlägt sich in einer Vielzahl von Forschungsprojekten nieder, von welchen einige in dem von der DFG geförderten internationalen wissenschaftlichen Netzwerk ‚Fokus Fortifikation. Befestigungen im östlichen Mittelmeerraum‘ zusammengefasst waren. In diesem Netzwerk wurden erstmals bislang eher missachtete Aspekte von Befestigungsbauten dezidiert ins Visier genommen und eine Vielzahl von offenen Fragestellungen diskutiert. So wurde hier etwa die vorher oft auf die Wehrfunktion reduzierte Wahrnehmung von Fortifikationen und die Konzentration auf typologische Studien ihrer einzelnen Elemente systematisch durchbrochen, sie wurden vielmehr als bewusst errichtete Elemente des gebauten Raums betrachtet und als Spiegel sozialer, politscher und kultureller Bedingungen analysiert. Thema war in diesem Rahmen auch die Frage der Art und Gewichtung über den Wehrcharakter hinaus gehender Funktionen, die angesichts der oft monumentalen Ausgestaltung, mancherorts deutlich überdimensionierten Verläufen, teils beachtlicher und mehr als nur einem Wehrzweck gerecht werdender handwerklicher Präzision und des nicht selten hohen ästhetischen Aufwands virulent erscheint. Bisher wurde diese jedoch nur in Einzelfällen mit regionaler und/oder chronologischer Begrenzung und ohne tiefergehende Analyse behandelt. Die nähere Bearbeitung der Frage nach den verschiedenen Funktionen von Befestigungswerken auf dem 3. Netzwerktreffen in Ephesos (Türkei) im Oktober 2009 ergab neben ersten richtungsweisenden Ergebnissen (publiziert in Müth u.a. 2016 und Frederiksen u.a. 2016), dass nur eine umfassende und detaillierte Studie antiker Befestigungen hinsichtlich ihrer verschiedenen Funktionsarten einer Beantwortung der Frage nach dem Vorhandensein, dem genauen Charakter, den Ausdrucksformen, den Voraussetzungen und den Entwicklungen symbolischer Funktionen in einer übergreifenden Form gerecht werden kann.
Neben der Befestigungsforschung ist das Projekt mit seiner speziellen Thematik auch in die aktuellen Tendenzen der Symbolforschung einzuordnen. Hier wurden von Christoph Baumberger mit einer 2010 erschienenen Publikation einer Symboltheorie der Architektur, in welcher er die Symboltheorie Nelson Goodmans auf die Architektur anwendet, teils modifiziert und grundlegend erweitert, neue Maßstäbe gesetzt[1]. Damit ist erstmals ein Instrumentarium gegeben, das es erlaubt, bestimmte Bauwerke im Lichte der Architektursemiotik zu begreifen. Indem die in dieser Symboltheorie vorgestellten Symbolisierungsweisen im vorliegenden Projekt für antike Befestigungen untersucht werden, wird das Projekt auch einen Beitrag zur Anwendung und Anwendbarkeit dieser neuen symboltheoretischen Grundlagen bezüglich spezifischer Architekturgattungen liefern und ihre Ergebnisse in diesen Ansätzen spiegeln können.
Projektziele und -aufgaben
Ziel des Projektes ist in erster Linie die Ermittlung des Umfangs und Charakters von symbolisch-repräsentativen Funktionen antiker Befestigungen, ihrer Motivationen, Ausdrucksformen und Aussagen sowie die Analyse ihrer Wandlungen in den historisch-politischen, gesellschaftlichen, chronologischen und regionalen Horizonten der griechisch-römischen Antike. Somit soll die Bedeutung von antiken Befestigungsbauten als gesellschaftliche Monumente herausgearbeitet werden, die – so die Arbeitsthese – die Wehrfunktion häufig sogar überwiegt. Als Mittel zu diesem Zweck, aber gleichzeitig auch als weiteres, nicht unbedeutendes Projektziel ist die Entwicklung einer allgemeinen Methodik zur Abgrenzung der verschiedenen Funktionen einer Befestigung voneinander bzw. die Untersuchung ihrer Überlappungen zu sehen.
Die Entwicklung einer geschärften Methodik und die Definition von exakten Kriterien zur Ermittlung über die Wehrfunktion hinaus gehender Zwecke sowie die Diskussion von Methoden zur Abgrenzung verschiedener symbolischer Zwecke voneinander, jeweils ausgehend von der Phänomenologie antiker Befestigungen und gespiegelt an den historisch-politischen und gesellschaftlichen Kontexten, sind die Grundlage für die geplante Studie. Basierend darauf ist das nächste Ziel, unter Anwendung dieser Methoden auf charakteristische Beispiele antiker Fortifikationen der verschiedenen Regionen und Epochen die symbolischen Funktionen zu systematisieren, ihre Ausdrucksmittel und -formen, ihre präzisen Aussagen, ihre ‘Sender‘ und ‚Adressaten‘ und deren mögliche politische, gesellschaftliche oder private Motivation zu ermitteln und eine chronologische und regionale Kartierung ihres Auftretens anzufertigen. Auf diese Weise kann anschließend eine Analyse des Zusammenhangs symbolisch-repräsentativer Funktionen von Befestigungen mit den verschiedenen historischen, politischen und gesellschaftlichen Bedingungen ihres Entstehens sowie eine Untersuchung ihrer Veränderungen in den regionalen, historisch-politisch-gesellschaftlichen und chronologischen Horizonten der Antike erfolgen. Als Arbeitsthese wird davon ausgegangen, dass symbolische Funktionen von Befestigungen einerseits von ihrem unmittelbaren innen- und außenpolitischen Entstehungskontext sowie von regionalen Faktoren abhängen, andererseits aber auch einer eigenen, gattungsspezifischen Entwicklung unterliegen, die zu analysieren ist.
Vorgehensweise und Methoden
Die Methodologie zur Abgrenzung symbolischer Funktionen von der ganz praktischen Wehr- und Schutzfunktion und zur Benennung der Graubereiche, in welchen eine Abgrenzung der verschiedenen Funktionen nicht eindeutig möglich ist oder Überlappungen in der Natur der Sache liegen, steht am Anfang. der Methodendiskussion und -erarbeitung des Projektes Eine der wichtigsten Ausgangsthesen lautet, dass alles, was unter den jeweils gegebenen historisch-politisch-gesellschaftlichen Bedingungen eines befestigten Ortes über eine angemessene technische Funktionalität zum Schutz und zur Verteidigung hinausgeht oder dieser sogar widerspricht, auf potenzielle symbolische Funktionen hinweist. Hierbei muss zunächst definiert werden, wie sich überhaupt eine solche ‚Angemessenheit‘ der Schutz- und Verteidigungsfunktion bestimmen lässt, d. h. welche Aspekte berücksichtigt werden müssen, um zu einer möglichst objektiven Definition dieser Angemessenheit zu gelangen. Einerseits sind dies technische Aspekte, die u. a. den Stand der Bau- und Wehrtechnik der jeweiligen Zeit, die regionalen Traditionen, Kenntnisse und Fähigkeiten in Handwerk und Architektur sowie die zur Verfügung stehenden Mittel, Materialien und Arbeitskräfte umfassen, andererseits die konkreten historisch-politisch-gesellschaftlichen Kontexte wie etwa die aktuelle Bedrohungslage auf verschiedenen Ebenen, die Bündnissituation nach außen, die auch mögliche Unterstützung beim Bau einer Befestigung einschließt, sowie die innenpolitischen und gesellschaftlich-sozialen Voraussetzungen. Hinzu kommen geographisch-topographische Gesichtspunkte, d.h. es muss abgewogen werden, welche Stärke und Ausstattung der Befestigung unter den jeweiligen geographischen und topographischen Bedingungen eines Ortes zur effizienten Verteidigung notwendig waren und inwieweit die örtliche Topographie für die fortifikatorische Effizienz einer Befestigung genutzt wurde – oder vielleicht stärker noch für ihre Inszenierung. Es muss nicht eigens betont werden, dass für die Definition einer solchen ‚Angemessenheit‘ – die notwendigerweise der Subjektivität der heutigen Betrachtung unterliegt, der nicht wenige Aspekte der antiken Situation entgehen mögen – der Vergleich möglichst vieler Befestigungsanlagen einer bestimmten Region zu einer gewissen Zeit elementar ist.
Anschließend können die über das zur Verteidigung angemessene Maß hinausgehenden Merkmale einer Befestigung benannt und auf ihren repräsentativen und symbolischen Gehalt überprüft werden. Es muss hier festgehalten werden, dass keinesfalls eine scharfe Grenze zwischen Wehr- und symbolischen Funktionen zu ziehen ist. Es wird notwendigerweise immer einen Graubereich geben, innerhalb dessen gewisse Merkmale nicht eindeutig zuzuweisen sind: ob sie beispielsweise auf bau- oder wehrtechnisch-funktionale, dem heutigen Betrachter sich jedoch nicht mehr erschließende Gründe, auf regionale Traditionen oder auf eine dezidierte Repräsentationsabsicht zurückgehen, ist nicht immer zweifellos feststellbar. Das Heranziehen möglichst vieler Beispiele für solche Merkmale und die Analyse ihrer Motivationen ist für ihre Beurteilung essentiell. Auch herrschen fließende Übergänge und Überlappungen zwischen wehrfunktionalen und symbolischen Eigenschaften und es dürften verschiedenen Phänomenen oft mehrere Ambitionen gleichzeitig zugrunde gelegen haben. Solche natürlichen und notwendigen Überlappungsbereiche zu definieren ist daher auch wichtiger Teil der Methodendiskussion. Daraufhin gilt es, die Möglichkeiten zur Definition und Trennung verschiedenartiger symbolischer Funktionen einer Befestigung zu diskutieren bzw. eine entsprechende Methodik zu entwickeln. Hier werden die individuellen Merkmale, die auf solche Funktionen hinweisen können, d. h. die ‚Träger‘ der Botschaften betrachtet und ihre immanenten Aussagemöglichkeiten, also ihre ‚Botschaften‘ untersucht, die Möglichkeiten und Wege ihrer Interpretation im Lichte der jeweils gegebenen historisch-politisch-gesellschaftlichen Kontexte sowie die Methoden, etwas über die ‚Hintermänner‘, also die Träger der symbolischen Absichten, sowie ihre Zielgruppe herauszufinden, also über die Identität der ‚Sender‘ und der beabsichtigten ‚Empfänger‘ der Botschaften. Dabei werden auch allgemeine, einem Befestigungsbau ohnehin automatisch immanente Wirkungen auf den Betrachter (wie Abschreckung, Demonstration von Monumentalität, Stärke, Verteidigungsfähigkeit, Abgrenzung nach außen, Zusammengehörigkeit, Zusammenhalt und Unabhängigkeit) definiert und festegestellt, wie sich die besondere Hervorhebung solcher Eigenschaften (ihre ‚Exemplifikation‘ nach Baumbergers Terminologie[1]) und damit der Übergang zur bewussten symbolischen Aussage bei bestimmten Befestigungen bemerkbar macht und fassen lässt. Weiterhin wird diskutiert, wo der Übertritt von bloßer allgemeiner Repräsentationsabsicht, die ebenfalls an sich schon eine symbolische Funktion darstellt, zu dahinterstehenden, weitergehenden Aussageabsichten stattfindet und wie dieser – meist nur unter Hinzuziehung weiterer Informationsquellen historischer oder archäologischer Art – greifbar wird.
Mithilfe der entwickelten Methodik werden daraufhin symbolische Funktionen griechischer und römischer Befestigungen innerhalb der jeweiligen Epochen anhand der aussagekräftigsten Beispiele analysiert, wofür eine intensive Materialsammlung und –studie die Grundlage bildet. Dabei wird jedoch ganz dezidiert kein Kataloges erstellt, da dies den Rahmen der Arbeit bei weitem sprengen würde, sondern für jede Epoche der griechischen und römischen Antike sowie für verschiedene Regionen eine Auswahl von charakteristischen Beispielen in möglichst repräsentativer Anzahl besprochen, die sich für das Erzielen genereller Ergebnisse eignet. Diese Auswahl richtet sich in großem Maße nach dem jeweiligen Erhaltungszustand, der Publikationslage bzw. der Zugänglichkeit der Monumente für autoptische Betrachtung. Des Weiteren ist das Bild von Wehrbauten in Schriftquellen und der bildenden Kunst von Bedeutung, da sich daraus Rückschlüsse auf ihr Funktionsverständnis in der antiken Kultur gewinnen lassen.
Die verschiedenen in den Einzelfallstudien dieses chronologisch und regional gegliederten Abschnitts festgestellten symbolischen Funktionen von Befestigungen werden im Anschluss daran anhand ihres Charakters und der hinter ihnen stehenden Motivation epochen- und gebietsübergreifend systematisiert. Erst durch eine solche vergleichende Gegenüberstellung der Verwendung einer gewissen Zeichensprache zum Ausdruck bestimmter symbolischer Funktionen in den verschiedenen Epochen und unterschiedlichen politischen, kulturellen und geographischen Gegebenheiten kann eine strukturelle Analyse dieser ‚Codierung‘ und ihrer Abhängigkeit von bzw. ihrer Wechselwirkungen mit diesen Faktoren erfolgen und ein generelles Bild der symbolischen Funktionen antiker Befestigungen gewonnen werden. Zunächst ist generell zwischen immanenten und spezifischen symbolischen Funktionen zu unterscheiden. Als immanente symbolische Funktionen von Befestigungen definieren sich solche, die Befestigungen unabhängig von Ort und Zeit ihrer Errichtung innewohnen, ohne dass dies unbedingt dezidiert durch ihre Form betont werden musste – wobei gleichwohl erst die Betonung, die ‚Exemplifikation‘ eine beabsichtigte symbolische Funktion anzeigt. Hierbei lassen sich bei den einzelnen Monumenten verschiedene Stärkegrade der Betonung dieser immanenten Funktionen feststellen, die durch eine bestimmte Gestaltung der Befestigung erreicht werden konnten. Daraufhin sind die nicht-immanenten symbolischen Funktionen zu systematisieren, die ortsspezifische Bezugnahmen auf Ereignisse oder Situationen darstellen, so etwa die durch die Verbauung von Spolien oder Inschriften ausgedrückte Rolle von Befestigungen als historische Denkmäler[3], die Bedeutungsbelegung als öffentliche oder private Monumente durch die Integration von Bauten, Grabmälern oder Inschriften, die kultischen Funktionen, die durch die Einbeziehung von ganzen Heiligtümern oder Kultorten, Statuen und Inschriften erzeugt werden können, die Bezugnahmen in Form von ‚Denotation‘ oder ‚Anspielung‘ auf spezifische andere Monumente und zum Schluss die Funktionsveränderungen, die mit Umnutzungen oder Umbauten einhergehen.
Zum Schluss wird der Wandel symbolischer Funktionen von Befestigungen in der Antike thematisiert: hierbei soll prägnant herausgearbeitet werden, inwiefern sich die Verwendung von Wehrbauten zur Aussendung symbolischer Botschaften und der konkrete Ausdruck solcher Botschaften an den Befestigungen, also die Sprache, mit der die Botschaften kommuniziert werden, unter den verschiedenen regionalen und politisch-gesellschaftlich-kulturellen Bedingungen sowie im Wandel der Epochen des Altertums verändert und worin die Gründe dafür zu suchen sind. Damit soll die Frage nach dem Einfluss der jeweiligen Kontexte auf Funktion und Erscheinungsbild von Befestigungen beantwortet, umgekehrt aber auch die Wirkung der Befestigungsbauten auf ihre Umgebung und deren Entwicklung erörtert werden. Auch muss abschließend eine Auseinandersetzung mit der erarbeiteten Symboltheorie und –praxis der Fortifikation im Spiegel der schon vorliegenden Symboltheorie der Architektur erfolgen, wobei auch die Anwendbarkeit letzterer für den Bereich der Befestigungen evaluiert werden.