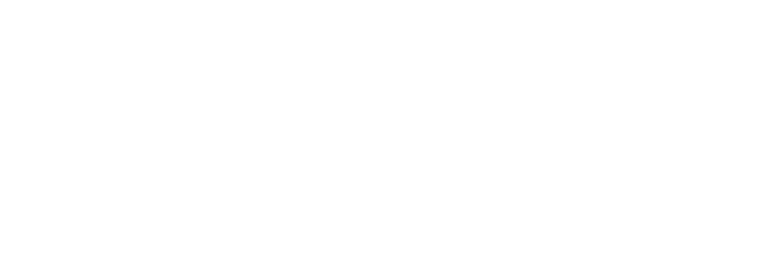Forschung
Bereits im Februar des Jahres 1446 besuchte als einer der ersten Forschungsreisenden bei seiner Fahrt entlang der kleinasiatischen Küste der italienische Kaufmann und Gelehrte Cyriacus von Ancona (1391–1452) das damals »Geronta« genannte Heiligtum und identifizierte die mächtige Ruine als den Apollontempel von Didyma.
Die erste Etappe der hier nur skizzierten fast 250-jährigen Forschungsgeschichte des Apollontempels von Didyma markiert die zeichnerische Aufnahme der ionischen Säulenordnung des Tempels durch den Architekten Nicholas Revett im Jahre 1765 während einer der Expeditionen der »Society of Dilettanti«, die in den 1769 erschienenen »Antiquities of Ionia« publiziert wurde und den hellenistischen Tempel von Didyma als bedeutendes Werk der griechischen Baukunst bekannt machte.
Die Ausgrabungen am Tempel wurden dann im Jahre 1872/1873 von Olivier Rayet und Albert Thomas begonnen und 1895/1896 von Bernard Haussoullier und Emanuel Pontremoli fortgesetzt, denen es gelang, die Ostfront freizulegen und im Hof einen Längsgraben zu ziehen. Den ersten archäologischen Hinweis auf den literarisch überlieferten archaischen Tempel stellte ein 1896 beim Tempel entdeckter marmorner Eckfriesblock mit einer von einem Löwen begleiteten Gorgo dar.
Die systematische Freilegung des in einem riesigen Trümmerberg verschütteten, von einer Windmühle bekrönten hellenistischen Apollontempels gelang dann erst 1906 bis 1913 während der jeweils mehrmonatigen Ausgrabungskampagnen der Königlich-Preußischen Museen in Didyma unter der Leitung des Archäologen Theodor Wiegand (1864–1936) und seines Architekten Hubert Knackfuß (1866–1948).
Neben zahllosen Baugliedern des hellenistischen Tempels kamen bei der alten Ausgrabung auch einige Architekturfragmente des archaischen Vorgängers zutage, wie z. B. Bruchstücke von Säulentrommeln aus Marmor und ›Poros‹, von marmornen ionischen Volutenkapitellen und sog. ephesischen Säulenbasen, sowie darüber hinaus Fragmente außerordentlich qualitätvoller bemalter marmorner Bauskulptur – Bruchstücke von reliefierten Säulentrommeln, sog. columnae caelatae, mit Koren (Mädchenfiguren) im Halbrelief sowie zwei Eckfriesblöcke mit Gorgonen. Im Inneren des Hofes des hellenistischen Tempels konnten schließlich 1915/1916 unter der Ruine einer byzantinischen Kirche die lang erhofften Reste des Adyton-Fundaments des archaischen Tempels freigelegt werden. Ein kurzer Vorbericht zum »vorpersischen Apollontempel« erschien 1941 im dreiteiligen Band I der Didyma-Publikation (H. Knackfuß, Didyma 1 [Berlin 1941] 121–129).
Eine erste Rekonstruktion auf einer damals unzureichenden Grundlage des nur partiell publizierten und zugänglichen Materials legte 1963 Gottfried Gruben in einem Artikel vor (JdI 78, 1963, 78–177): Er rekonstruiert anhand von rund 25 marmornen Werkstücken einen ionischen Dipteros mit 8/9 × 21 Säulen in der äußeren Ringhalle, einem übermäßig lang gestreckten hypäthralen Hof mit wie am hellenistischen Nachfolger durch Pilaster gegliederten Wänden und einem tiefen Pronaos mit acht Säulen. In der jüngsten Grundrissrekonstruktion in der fünften überarbeiteten Ausgabe seines Standardwerks (Griechische Tempel und Heiligtümer 5(München 2001)) revidierte Gruben, offenbar auf der Grundlage von Heinrich Drerups Grabungsergebnissen und Überlegungen, seine alte Rekonstruktion dann partiell, verkürzte den Adytonhof und ergänzte hypothetisch einen vom Hof und vom Pronaos jeweils durch Treppen erreichbaren, erhöhten archaischen ›Zweisäulensaal‹, einen Vorläufer des hellenistischen Saals. Die extrem schlank rekonstruierten Säulen des ›Marmortempels‹ von 1963 mit breit ausladenden Volutenkapitellen ruhen auf ephesischen Basen und tragen ein filigran erscheinendes Gebälk.
Die Revision der Bauglieder der ›alten Ausgrabung‹ in den 60er Jahren zu Beginn der durch das DAI wiederaufgenommenen Ausgrabungen in Didyma sowie das beträchtliche Anwachsen der archaischen Architekturfragmente in den letzten Jahrzehnten ließen eine systematische Aufnahme der Werkstücke dringend geboten erscheinen: In zehn mehrwöchigen Aufarbeitungskampagnen in den Architekturmagazinen in Didyma seit 2003 sowie drei Aufarbeitungskampagnen in den Magazinen und der Ausstellung des Antikensammlung zu Berlin (2005, 2012, 2014) konnten rund 600 dem archaischen Apollontempel und seinem Altar zuweisbare Architektur- und Bauskulpturfragmente katalogmäßig, photographisch und zeichnerisch aufgenommen und detailliert untersucht werden, die die Grundlage für die Rekonstruktion des Grund- und Aufrisses und die bau- und kunsthistorische Einordnung des Tempels in die archaische ionische Architektur bilden, die in einer geplanten Monographie vorgelegt werden.