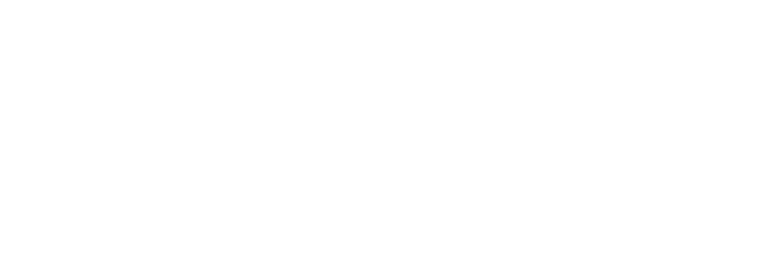Forschung
Das Projekt ist interdisziplinär angelegt: Neben der punischen, römischen und spätantiken Archäologie ist auch die Bauforschung vertreten, ebenso werden naturwissenschaftliche Untersuchungen durchgeführt. Aufgrund der großen Fläche im Untersuchungsgebiet wurde als Strategie für die Feldforschung zunächst die geophysikalische Prospektion gewählt, der in der ersten Feldforschungsphase von 2015 bis 2017 die gezielte Anlage von drei Sondagen folgte. Ausgangspunkt für die Untersuchungen war zunächst der dominante römische Großbau im südlichen Teil des Stadtviertels, der Circus. Die Sondagen hier dienten der Klärung der Chronologie, Lage, Gestalt und der Vor- und Nachgeschichte des Monuments.
Durch die Prospektion des Geländes wurden drei Sondagepunkte festgelegt: im Bereich der Arena, im Bereich der nördlichen Zuschauerränge und im Bereich der Mittelachse des Circus, der Spina. Die Sondage innerhalb der Arena erbrachte erste Ergebnisse zur Nutzung des Geländes in punischer Zeit. Es konnten eine Reihe von beckenartigen Abarbeitungen im natürlich anstehenden Fels dokumentiert werden, die im Zusammenhang mit Pfostenlöchern, die sich zu mindestems einen, wahrscheinlich zwei aufeinanderfolgenden Bauten ergänzen lassen, als Konstruktionen im Zusammenhang mit handwerklichen Tätigkeiten zu sehen sind. Erstmals gelang in Karthago somit der Nachweis von Pfostenständerbauten der punischen Zeit, in diesem Fall genauer gesagt der mittel- und spätpunischen Zeit des 5. bis 2. Jh. v. Chr. Ferner enstanden wohl gegen Ende dieser Nutzungsphase oder bereits in nachpunischer Zeit (das Studium der Keramik ist noch nicht abgeschlossen) auch Mauern, die jedoch in frührömischer Zeit niedergelegt wurden. Man errichtete nun ein Fundament für ein Mausoleum, das jedoch selbst nicht lange Bestand hatte sondern seinerseits unter dem Boden der Arena für Wagenrennen verschwand, im frühen 2. Jh. n. Chr.
Der Baubeginn für den Circus begann jedoch bereits früher, wie wir in einer Sondage an die erhaltenen Reste der Mittelbarriere, der Spina, nachweisen konnten. Die Spina wurde bereits im späten 1. Jh. n. Chr. errichtet. Dazu wurde zunächst ein äußerer Mauerring errichtet, der mindestens 1,80 m in den Boden reichte (die Sondage ist noch nicht abgeschlossen). Das Innere dieser insgesamt 10 m breiten Struktur wurde mit Caementitiumsschichten aufgefüllt, die jedoch nicht tief in den Boden reichten. Diese wurden offenbar von zwei äußeren Mauern aus Steiquadern gehalten. Auf der Spina befanden sich Wasserbecken sowie Aufbauten in in ihren Dimensionen reduzierter Architektur, wie Funde zeigen. Westlich vor der Spina konnte die „meta secunda“ identifiziert werden, die Wendemarke, die die Wagen passierten, wenn sie von der nördlichen Arenalänge erneut auf die südliche einbogen (man fuhr gegen den Uhrzeigersinn). Der Arenaboden, der hier noch dokumentiert werden konnte, wurde vom 1. bis 5. Jh. ausgebessert, was einen wichtigen Hinweis für die Nutzung der Anlage insgesamt gibt.
Die Sondage im Bereich der Zuschauerränge erlaubte eine Rekonstruktion des Aufbaus der Zuschauerränge. Wir konnten nördlich der Mittelbarriere den Punkt nachweisen, an dem die Arena an die Podiumsmauer anlief, die sich noch deutlich als Raubgrube abzeichnete. Hinter der Podiumsmauer befand sich ein Durchgang parallel zur Arena, der offenbar der Erschließung der unteren Ränge diente. Hinter diesem Gang befand sich in situ eine erste Caveamauer in ruinösem Zustand erhalten. Auf dieser ruhte das Tonnengewölbe, das die eigentlichen Caveasitze trug, von denen sich mehrere in Raubgruben fanden. Der hintere Abschluss der Cavea wird durch eine große Raubgrube angezeigt. Im späten 2. bzw. frühen 3. Jh., wie wir durch eine C14-Datierung erhaltenen Baumörtels nachweisen konnten, fand eine Erweiterung der Cavea mittels massiver Pfeiler aus El-Haouaria Stein statt (vermutlich in Zweitverwendung). Die nördliche Cavea erreichte nun eine Breite von rund 17 m. Zu rekonstruieren sind zwanzig Sitzreihen sowie vermutlich eine Kolonnade als oberen Abschluss. Vorgelagert vor der Cavea fand sich nördlich ein erhaltenes Steinpflaster, wie es für römische Straßen bzw. Bodenbereiche von Großbauten typisch ist. Ebenfalls im Norden haben sich eine ganze Reihe von späten Bodenniveaus und Spolienmauern vor allem des 6. und 7. Jhs. erhalten, die auf eine Umnutzung des Monuments und eine Umgestaltung des Areals hindeuten. Islamische Keramik aus den Raubgruben deutet den Beginn des Abbaus des Monuments für diese Zeit an.