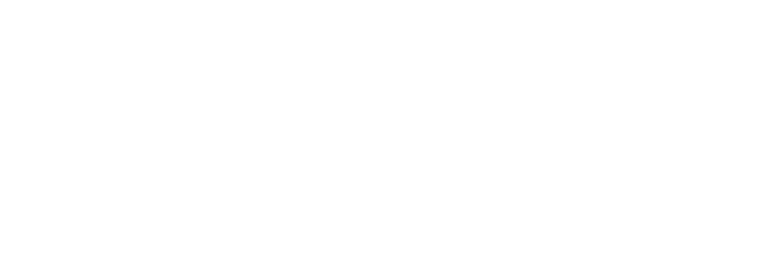Ergebnisse
Die Grabungs- und Forschungsergebnisse der letzten zehn Jahre ermöglichen sowohl ein umfangreicheres Bild über die Bestattungsgewohnheiten als auch über die architektonische Entwicklung der Grabanlagen in der Frühzeit zu liefern.
Die bauforscherische Untersuchung hat zum Ergebnis, dass die Grabanlage des Ninetjer in der ersten Bauphase dem klaren Entwurfsprinzip des benachbarten Grabes von Hetepsechemui/Raneb folgt, welches sich in den Privatgräbern der mittleren 2. Dynastie wieder finden lässt. Während der nördliche Grabbereich seitlich der Rampe durch die Anordnung von Magazinräumen wohl der Lagerung von Vorräten vorbehalten war, bildet der Südosttrakt Bereiche des Königspalastes modellhaft nach. Der Unterschied zwischen Königs- und Privatgrab liegt sowohl in der Monumentalität als auch in der Zufügung einer neuen Entwurfskomponente: dem Modellkultplatz. Dieser Modellkultplatz bestand aus einem massiven Felsblock bzw. Scheinhaus, welches im Zusammenhang mit dem Sedfest und einem rituellen Lauf des Königs gedeutet werden kann. Wahrscheinlich kann die „Blaue Kammer“ im Nord- und Südgrab des Djoserbezirks entwicklungsgeschichtlich auf den Felsblock im Grab des Hetepsechemui zurückgeführt werden. Bemerkenswert dabei ist das abstrakte Vorstellungsvermögen, wobei bereits zu Beginn der 2. Dynastie „nichtfunktionsfähige“, massive Gebäude ohne Innenräume ein reales, diesseitiges Bauwerk abbilden. Der Kultplatz wurde sozusagen auf seine wichtigsten Elemente, ein Modellhaus und der den Kultlauf ermöglichende Korridor in abstrakter Weise reduziert. Im Unter-schied zu Hetepsechemui wird beim Grab des Ninetjer eine weitere neue Entwurfskomponente hinzugefügt: die Modellstadt. Mit dieser Interpretation konnte erstmals der labyrinthartige Entwurf, der zur Lagerung von Vorräten völlig ungeeignet ist, erklärt werden. Die labyrinthartig angeordneten Gänge wurden nicht als lange Korridore mit kleinen Kammern, sondern als Straßen mit Hauseingängen entworfen. Diese Art von pars pro toto Denken, bei welchem der Haus-/Magazineingang als Platzhalter für ein reales Gebäude steht, lässt sich wie der unterirdische Modellkultplatz auch in den oberirdischen Gebäuden im Djoserbezirk wiederfinden.
Von den Funden der 2. Dynastie konnten bislang die Verschlüsse mit Siegelabrollungen untersucht werden (Bearbeiterin: I. REGULSKI). Dabei handelt es sich sowohl um Verschlüsse, die bereits durch P. MUNRO ausgegraben wurden, als auch um Siegelabrollungen, die in den letzten Jahren zum Vorschein kamen. Die Hauptgruppe bilden kegelförmige Gefäßverschlüsse aus Mergel (taffl), mit welchen Weinflaschen verschlossen waren. Einige Weinflaschen konnten sogar mit intaktem Verschluss geborgen werden. Kleinere, flache taffl-Verschlüsse dienten wohl dem Verschließen von bauchigen Gefäßen mit roter Streifenpolitur. Weiterhin kamen Schnur- und Beutelverschlüsse, sowohl aus taffl, als auch aus Nilschlamm zum Vorschein. Von besonderem Interesse waren runde, geflochtene Körbe, die im Raum A500 zwischen den Weinflaschen geborgen werden konnten. Auch diese wurden am Rand mit einem wulstförmigen Verschluss versiegelt. Die übrigen Fundgruppen befinden sich weiterhin in der Bearbeitung (Steingeräte: S. BOOS, Keramik: R. HARTMANN).
Weitere neue Erkenntnisse ergaben sich bei der Untersuchung der späteren Nutzungsphasen, durch welche die frühzeitlichen Galerien mit Schächten erschlossen bzw. durchbrochen wurden. Zu unterscheiden sind große rechteckige Schächte mit sorgfältig gemauerter Schachtkrone (spätes Neues Reich) und kleinere quadratische Schächte, deren Schachtkrone lediglich aus losen Bruchsteinen in Kombination mit Nilschlammziegel besteht (Spätzeit). Während die rechteckigen Schächte aus dem späten Neuen Reich mit den vorgefunden Räume des 2. Dynastiegrabes kombiniert wurden, erschließen die quadratischen spätzeitlichen Schächte oftmals tiefer liegende Familienkrypten. Der gestörte Zwischenraum im Bereich der frühzeitlichen Räume wurde zugemauert. Letztlich wird das gesamte Grab als eine Art Katakombe genutzt, wobei die Bestattungen unmittelbar auf dem Boden bzw. Bänken des 2. Dynastiegrabes niedergelegt worden sind. Zur Unterteilung der langen Gänge wurden dabei kleine Trennmauern eingezogen.
Bei der Aufarbeitung des Fundmaterials der späteren Nutzungsphasen konnten vor allem bei der Untersuchung der Särge und Sargfragmente unter der Vielzahl der Objekte eine Sondergruppe mit Särgen in Festtagstracht herausgearbeitet werden, die sich ins späte Neue Reich datieren lassen (Bearbeiterin: S. BOOS). Im Unterschied zu den üblichen Darstellungen des Verstorbenen als Toter, d.h. als Osiris mit Nemeskopftuch und über der Brust gekreuzten Armen, wird bei diesem Sargtyp der Verstorbene als lebende Person dargestellt. Die Särge sind anthropoid geformt, der Verstorbene ist mit einer Perücke im Festtagsgewand abgebildet. Während bei maskulinen Särgen die Arme lang gestreckt neben dem Körper liegen, ist bei Särgen für eine Frau ein Arm über der Brust gekreuzt.