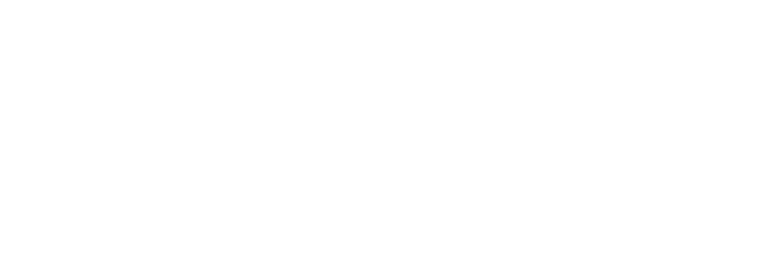Forschung
Das Hauptziel der Untersuchung ist die Zusammenstellung seismologischer, morphologischer und ingenieurgeologischer Daten, um ein archäoseismologisches Modell der Situation in der Argolis während des zur Diskussion stehenden Zeitraums zu erstellen. In Kombination mit den schon bestehenden archäologischen Erkenntnissen, der numerischen Simulation der Topographieeffekte und einer modernen ingenieurseismologischen Modellierung der architektonischen Schlüsselstrukturen in Midea und Tiryns soll das Modell verwendet werden, um die Hypothese der seismogenen Ursachen der beobachteten Bauschäden quantitativen Tests zu unterziehen.
Der Untergang der mykenischen Paläste markiert einen der tiefgreifendsten Wendepunkte in der Geschichte Griechenlands und gehört weltweit zu den markantesten Beispielen unvermittelten politischen Kollapses. Selbst in der Argolis, d.h. derjenigen mykenischen Palastregion, die nach 1200 v. Chr. noch am ehesten Anzeichen eines Wiedererstarkens erkennen lässt, verschwinden nach dem Zerstörungshorizont Merkmale wie Monumentalarchitektur, Schriftlichkeit, Großkunst und politische Komplexität, weshalb auch hier die Tiefe des politischen und historischen Einschnitts in ganzer Klarheit hervortritt. Während bis in die 1970er Jahre in der archäologischen Literatur die Zerstörungen auf kriegerische Aktivitäten zurückgeführt wurden, kam es in den 1980er Jahren zu einem Paradigmenwechsel in der Erklärung des Untergangs der Paläste. Aufbauend auf der Beobachtung von Zerstörungsmustern an Bauwerken in Midea und Tiryns wurde ein starkes Erdbeben am Ende der Palastzeit postuliert und die Zerstörung der Paläste von Mykene und Tiryns sowie der Zitadelle von Midea hierauf zurückgeführt. Vor allem angesichts der Tatsache, dass die "Erdbeben-Hypothese" seitdem zur herrschenden Forschungsmeinung bei der Erklärung des kulturellen Umbruchs geworden ist und je nach Sichtweise der jeweiligen Forscher entweder teilweise oder gänzlich für den Untergang der mykenischen Paläste verantwortlich gemacht wird, erstaunt es festzustellen, dass diese Hypothese allein auf intuitiven archäologischen Beobachtungen und Erklärungen beruht, jedoch noch nie zum Gegenstand einer archäoseismologischen Überprüfung wurde. Ohne eine solche Überprüfung jedoch wird die Frage nach der Relevanz von Naturkatastrophen, insbesondere Erdbeben, beim Untergang der mykenischen Paläste weiter ohne klare Antwort bleiben. Diese Sachlage machte es dringend erforderlich, am Beispiel von Midea und Tiryns, d.h. denjenigen beiden Orte, die ausschlaggebend für die Formulierung der "Erdbeben-Hypothese" waren, die Frage, ob es tatsächlich Anzeichen eines großen Erdbebens um 1200 v. Chr. gibt, endlich in den Mittelpunkt eines archäoseismologischen Forschungsprojekts zu stellen.
Seit 2012 beschäftigt sich ein interdisziplinäres und internationales Forschungsvorhaben mit der Thematik der "Erdbeben-Hypothese". Dieses wird in Zusammenarbeit zwischen den Geowissenschaftlern Klaus-G. Hinzen (Universität Köln) und Heiner Igel (LMU München) sowie den Archäologen Joseph Maran (Universität Heidelberg), Alkestis Papadimitriou (Griechischer Antikendienst) und K. Demakopoulou (ehem. Nationalmuseum Athen) durchgeführt.
Das von der Gerda Henkel-Stiftung und der Fritz Thyssen-Stiftung geförderte Vorhaben hat es sich zum Ziel gesetzt, die erste umfassende archäoseismologische Untersuchung der Region Argolis in Angriff zu nehmen.