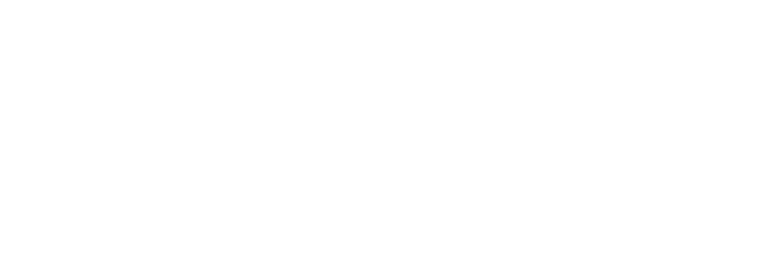Ergebnisse
Die Feldforschungsaktivitäten konzentrierten sich 2010-2012 auf die Erforschung der Feuersteinminen (Modul 1), die Kommunikationsrouten durch die Basaltwüstensteppe (Modul 3) und die künstlich bewässerten Felder und Gärten im direkten Umfeld von Jawa (Modul 4).
Modul 1: Spätchalkolitisch / Frühbronzezeitlicher Feuersteinbergbau in der Wadi ar-Ruwayshid Region
In zwei Kampagnen (2010 und 2012) erfolgte die eingehende Erforschung der Minenregion im Gebiet des Wadi ar-Ruwayshid in der Kalksteinwüstensteppe (al-hamad). Entdeckt wurden diese Minen im Jahr 2000 durch Ricardo Eichmann und Bernd Müller-Neuhof. Eine kleine Voruntersuchung im nördlichen Teil der Minenregion erfolgte bereits 2006 durch Bernd Müller-Neuhof (Müller-Neuhof 2006).
Diese Minen dienten ausschließlich der Gewinnung von Feuersteinrohmaterial für die vor Ort erfolgte Produktion von Rohlingen für sogenannte Cortexgeräte.
Die Cortexgeräterohlinge sind etwa handflächengroße Feuersteinabschläge, deren Dorsalseiten vollkommen mit Cortex, der äußeren Verwitterungsschicht von Feuersteinknollen, bedeckt sind. Sie stellen eine wichtige Fundgruppe des 4. und frühen 3. Jahrtausends v. Chr. in Vorderasien dar. Diese Abschläge, die durch Kantenretuschen zu schneidenden und schabenden Geräten weiterverarbeitet wurden, dienten wahrscheinlich vornehmlich der Verarbeitung von Tierprodukten (Schafschur, Verarbeitung von Tierhäuten, Zerlegen geschlachteter Tiere etc.).
Das Verbreitungsgebiet der Cortexgeräte, die in der Fachliteratur auch als 'tabular scraper' oder 'fanscraper' bezeichnet werden, erstreckt sich über weite Teile Vorderasiens, d. h. von Südostanatolien im Norden, über West- und Nordmesopotamien und der Levante, bis in den Süden nach Ägypten. Allerdings konnten bislang nur in zwei Regionen Minen nachgewiesen werden, in denen das entsprechende Rohmaterial abgebaut wurde und an denen sich auch die Produktionsplätze für die Geräterohlinge befanden. Hierbei handelt es sich um eine Region im Südosten Jordaniens am Nordrand der Jafr-Ebene die von den US-amerikanischen Archäologen Leslie Quintero, Phil Wilke und Gary O. Rollefson sowie von dem japanischen Archäologen Sumio Fujii untersucht werden. Die zweite Minenregion ist das im Rahmen dieses Projektes erforschte Wadi ar-Ruwayshid Gebiet am Westhang des ar-Risha Kalksteinplateaus.
Bislang sind lediglich aus dem Sinai und der Negev wenige kleine Schlagplätze bekannt, auf denen eine Handvoll solcher Geräterohlinge produziert wurden. Es erscheint daher plausibel, dass eine große Anzahl der an den diversen Siedlungsstandorten gefundenen Geräte, aus den beiden Minenregionen Jafr und Ruwayshid stammt.
Die im Gebiet des Wadi ar-Ruwayshid erfassten Minen verteilen sich auf drei Reviere, die alle am Westrand des ar-Risha Kalksteinplateaus liegen und zwar auf einem Niveau um die 800 m ü. NN (+/- 15m), was auf die geplante Nutzung einer bzw. mehrerer in dieser Höhe vorkommender Feuersteinlage(n) schließen lässt.
Die Minen befinden sich ausschließlich auf Spornlagen mit verhältnismäßig steilen Hängen.
Die Konzentration der Minenaktivitäten auf eine bestimmte Höhe und die genannten topographischen Bedingungen ermöglichten es, die Grenzen dieser Minenregion klar zu definieren und einzelne Minenreviere zu identifizieren.
Bei den Minen handelt es sich ausschließlich um obertägige Minen. Der Feuersteinabbau erfolgte teilweise durch das Anlegen flacher Gruben, da sich die Feuersteinlage sehr dicht unter der Oberfläche befand. Darüber hinaus wurde das Rohmaterial auch aus ausbeißenden Feuersteinlagen an den Hangkanten der Sporne herausgebrochen.
Bei den größten Minen handelte es sich um Grabenminen, die eine Länge von fast 1000m erreichen konnten und zwischen 20m und 50m breit waren. Die Grabenminen befanden sich auf den Plateaus der Sporne und verliefen entlang der Hangkanten.
Die Produktion der Cortexgeräterohlinge erfolgte direkt in den Abbauzonen. Sie ist vor allem durch die Negativabdrücke der Cortexabschläge auf den Feuersteinresten, den Kernen, belegt, die an den Abbau- bzw. Produktionsstandorten zurückgelassen wurden. Ebenfalls zurückgelassen wurde das Gezähe zum Abbau des Rohmaterials und zur Rohlingsproduktion. Hierbei handelte es sich um Hammersteine und Kerbschlägel aus Basalt.
Stichprobenartige Zählungen der Abschlagnegative ergaben, dass auf der insgesamt etwa 38 Hektar großen Gesamtfläche der Minen mindestens 2 Millionen Cortexgeräterohlinge produziert wurden.
Modul 2: Geochemische Charakterisierung des Rohmaterials aus den Feuersteinminen in der Wadi ar-Ruwayshid und Jafr Region und Durchführung von Provenienzanalysen.
Da nun zwei Minenregionen bekannt sind, in denen im geradezu „industriellen“ Maßstab Feuerstein abgebaut und Cortexgeräterohlinge produziert wurden, wurde geprüft, ob sich das Rohmaterial beider Regionen unterscheidet.
Dazu wurden während der Surveykampagnen 2010 und 2012 in beiden Minenregionen (Jafr und Ruwayshid) sowohl die Feuersteinlagerstätten in den Minen als auch die nicht genutzten Feuersteinvorkommen umfangreich beprobt und diese Proben dann mit der nicht zerstörenden Röntgenfluoreszenzanalyse auf Zusammensetzung und Quantität bestimmter Spurenelemente analysiert. Die statistische Auswertung der Analyseergebnisse findet zurzeit statt.
Eine bereits zuvor erfolgte Analyse einer kleinen Probenmenge mit der herkömmlichen Röntgenfluoreszenzanalyse an der TU-Darmstadt durch Dr. Norbert Laskowski, bei der die Probe zuvor zermahlen wird, erbrachten jedoch schon erste Hinweise auf Unterschiede in der Zusammensetzung und Konzentration bestimmter Spurenelemente im Rohmaterial beider Minenregionen.
Zukünftig werden diese Untersuchungen vielleicht nicht nur eine geochemische Charakterisierung einzelner Minenregionen sondern eventuell auch die Provenienzbestimmung einzelner Cortexgeräte, die in Siedlungen gefunden wurden, ermöglichen.
Modul 3: Archäologische Geländesurveys zur Identifikation möglicher Kommunikationsrouten durch die Basaltwüstensteppe in Richtung Jawa.
Mittels zweier Transektsurveys sollte der Verlauf möglicher Kommunikationsrouten, die arbeitshypothetisch die Kalksteinwüstensteppe (al-hamad) und somit die Minenregion im Wadi ar-Ruwayshid Gebiet mit Jawa in der Basaltwüstensteppe (al-harra) verbunden haben, identifiziert werden. Die wesentlichen Fragestellungen, die diesem Teilprojekt zugrunde lagen, bezogen sich auf die folgenden zwei Aspekte:
Weil weite Bereiche der Basaltwüstensteppe zumeist dicht mit Basaltbrocken bedeckt sind und dadurch nur mühsam durchquert werden können, sollte zunächst grundsätzlich die Erschließbarkeit und Durchquerbarkeit dieser auf den ersten Blick undurchdringbar erscheinende Basaltwüstensteppe geklärt werden.
Der zweite Aspekt betrifft die mögliche Rolle Jawas als Handelsstützpunkt und als Ort mit Kontrollfunktion über Teile der Nördlichen Badia. Eng damit verbunden war auch die Fragestellung inwiefern Jawa in den Handel mit Cortexgeräterohlingen involviert gewesen ist. Eine derartige Verbindung würde auch eine zumindest räumlich nachvollziehbare Anbindung der Wadi ar-Ruwayshid Minenregion an Jawa voraussetzen, da die Entfernung zwischen Jawa und der Minenregion ca. 140km (Luftlinie) beträgt.
Um diesen beiden Fragen nachzugehen, wurden zwei Transekte ausgewählt, die vom Ostrand der Basaltwüste nach Jawa verliefen. Der Verlauf dieser Transekte orientierte sich an einzelnen Wadis und den mit ihnen verbundenen Lehmpfannen, die die einzigen Möglichkeiten zur Fortbewegung in der Basaltwüstensteppe darstellen.
Tatsächlich konnte durch die Surveys im Herbst 2010 und im Frühjahr 2011 nachgewiesen werden, dass über Wadis und Lehmpfannen diese Region erschlossen und durchquert werden konnte. Hiervon zeugen zahlreiche Lagerplätze (Campsites) oft in Verbindung mit Pferchanlagen, in denen Schafe und Ziegen gehalten wurden. Daneben wurden auch sogenannte „kites“, große reusenartig angelegte Tierfallen aus Steinen identifiziert, deren Existenz in der Basaltwüstensteppe bereits lange bekannt ist.
Von großer Bedeutung ist die Identifikation der befestigten Höhensiedlung Khirbet Abu al-Husayn mit einer Toranlage und Zweischalenmauerwerk auf einem kleinen Vulkan am Ostrand der Basaltwüste am Rand der Lehmpfanne Qa’ Abu al-Husayn. Das bislang auf der Oberfläche identifizierte Fundmaterial deutet möglicherweise auf eine Datierung des Ortes in den Übergang vom Spätchalkolithikum in die Frühbronzezeit I.
Eine genauere Untersuchung mit der Dokumentation der architektonischen Reste dieses Ortes ist für das Frühjahr 2013 geplant.
Auf den Transektsurveys wurden diverse Lagerplätze identifiziert, die sich durch ihr Fundmaterial in unterschiedliche Perioden differenzieren lassen. Neben verstreuten Funden, die bereits auf menschliche Aktivitäten im Alt- bzw. Mittelpaläolithikum in dieser Region schließen lassen, datieren die ältesten identifizierten Lagerplätze und Schlagplätze in das Epipaläolithikum bzw. in den Übergang zum Präkeramischen Neolithikum A (PPNA). Ebenfalls sind vereinzelte Lagerplätze aus dem PPNB im Untersuchungsgebiet belegt.
In das Keramische Neolithikum datiert eine deutlich größere Zahl an Fundplätzen, wie auch eine außerordentlich große Zahl an Lagerplätzen und Pferchanlagen chronologisch in den Übergang Spätchalkolithikum / Frühbronzezeit einzuordnen ist. Bei diesen Anlagen sind häufig auch Nachnutzungen in römisch / byzantinischer bzw. frühislamischer Zeit (Ummayyadenzeit) zu beobachten, einem Zeitraum der, wie schon der Übergang vom Spätchalkolithikum zur Frühbronzezeit, von sehr intensiven menschlichen Aktivitäten in der Basaltwüstensteppe charakterisiert ist. In geringerem Umfang sind schließlich die Aktivititäten späterer islamischer Perioden wie der Abbassiden-, Mamluken- und der spätosmanischen Zeit belegt.
Diese Beobachtungen entsprechen den Klimaschwankungen in der Region. Sowohl die vergleichsweise geringe Präsenz post-ummayyadischer Funde als auch das Fehlen von Funden aus dem Zeitraum von der Mittleren Bronzezeit bis einschließlich der Eisenzeit sind mit deutlich trockeneren Klimabedingungen und somit einer deutlich geringeren bis gar keiner Frequentierung dieser Region z.B. durch Viehnomaden zu erklären.
Neben den Lagerplätzen und Pferchanlagen mit Lithik- und Keramikfunden sind auf den Surveys auch zahlreiche safaitische und arabische Felsinschriften gefunden worden. Von besonderer Bedeutung für das Projekt sind jedoch die prähistorischen Felsbilder, von denen einige wahrscheinlich in das 4. Jahrtausend v. Chr. datiert werden können. Vor allem die Darstellung von Langhornrindern lässt darauf schließen, dass diese zeitweise durch die Basaltwüstensteppe getrieben wurden, was wiederum auf günstigere Klimabedingungen in dieser Region im 4. und frühen 3. Jahrtausend v. Chr. hinweist.
Modul 4: Erforschung der künstlich bewässerten Ackerbauflächen im Umfeld von Jawa durch archäologische Fundplatzsurveys und hydrogeographische Untersuchungen.
Während der Ausgrabungen in Jawa in den 1970er und 1980er Jahren wurde unmittelbar bei Jawa im Wadi Rajil ein System künstlich angelegter Wasserspeicherbecken aus dem 4. Jahrtausend identifiziert, in die aus dem Wadi Rajil Wasser zur Speicherung eingeleitet wurde.
Während des Transektsurveys im Frühjahr 2011 sind im Umfeld Jawas künstlich bewässerte landwirtschaftliche Flächen identifiziert worden, deren Entstehung und Nutzung wohl hauptsächlich in die Hauptbesiedlungszeit Jawas zu datieren ist.
Zum einen handelt es sich um Felder auf Waditerrassen im Wadi Rajji westlich und östlich von Jawa, die mit Hilfe von Ableitdämmen und Kanälen mit Wadiwasser bewässert wurden, was allerdings nur zu den Jahreszeiten möglich war, in denen das Wadi Wasser führte. Diese Anlagen werden in der kommenden Surveykampagne im Frühjahr 2013 genauer dokumentiert.
Zum anderen konnten die bislang wahrscheinlich frühesten Hinweise auf Terrassenfeldbau mit Regenwasserabflussbewässerung (rainwater harvesting irrigation) in Vorderasien identifiziert werden. Auf einem Plateau gegenüber von Jawa wurden während einer Surveykampagne im Herbst 2011 Terrassengärten dokumentiert, die mit Hilfe von Kanälen künstlich bewässert wurden. Bei Regenfällen griffen Kanäle das Wasser von den Oberflächen naheliegender Hügel und Hänge ab und erhöhten damit erheblich die Wassermenge, die den Gärten zugeführt wurde. Das Wasser gelangte dann kaskadenartig von den obersten Gärten bis zu den am Fuß der Hänge liegenden Gärten, wobei verschließbare Überläufe und Wehre die Durchfeuchtung der Sedimente und den Durchfluss reguliert haben werden. Die Gesamtfläche dieser Gartenanlagen betrug etwa 33 Hektar. Der starke Flechtenbewuchs auf den Mauern deutet auf ein hohes Alter dieser Anlage hin. Entsprechende Oberflächenfunde lassen eine Datierung in den Übergang vom Spätchalkolithikum zur Frühbronzezeit zu, was auch plausibel erscheint, da eine große Zahl von Menschen durch diese Gärten ernährt wurde und auch nur eine große Zahl von Personen solche Gärte Instand halten konnte. Der genannte Zeitraum entspricht der Hauptbesiedlungsperiode von Jawa, in der der Ort auch die höchste Einwohnerzahl hatte.