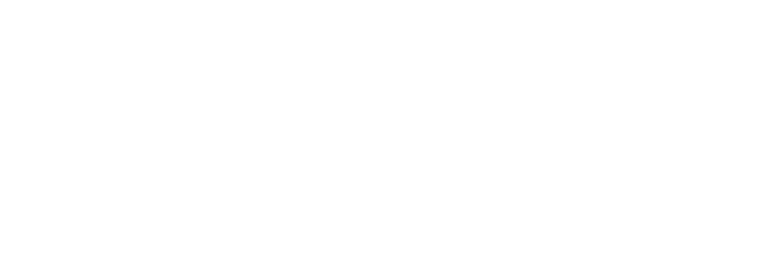Ergebnisse
Bisher wurde die Keramik mit archäologischen Methoden in zwei Hauptspektren – ein griechisch-römisches und ein Černjachov-Spektrum – gegliedert. Das griechisch-römische Spektrum ist in Schalen, Kannen und Krüge weiter zu unterteilen, das Černjachov-Spektrum umfasst neben Tischkeramik in größerem Umfang auch Töpfe als Küchengeschirr. Der Vergleich beider Spektren zeigt bei der Tischkeramik neben stilistischen Unterschieden technisch viele Ähnlichkeiten. Daher kann nur die Anwendung naturwissenschaftlicher Materialanalysen neue Ergebnisse zur Herstellungstechnik und der Herkunft der Gefäße erbringen. An 284 Proben von Gefäßen aus Olbia und neun weiteren Fundorten wurden mit einem portablen Gerät Röntgenfluoreszenz-Analysen durchgeführt, um die chemische Zusammensetzung der Pro¬ben zu erfassen. Durch die Anwendung weiterer Methoden (MGR-Analysen, Dünnschliffe) konnten danach Typen von Ton herausgearbeitet werden. Erste Ergebnisse zeigen, dass in den Proben des griechisch-römischen Spektrums ein Tontyp vorherrschend war, der aus einer Produktionsstätte stammt und sich in Proben aus fast allen untersuchten Orten der Chora des 1.-3. Jhs. findet. Demgegenüber weist die Černjachov-Keramik an jedem Ort spezifische Tontypen auf, was für eine vorwiegend lokale Keramikherstellung im 3./4. Jh. spricht. Daraus ergeben sich für die weitere Auswertung deutlich verbesserte Ansätze.