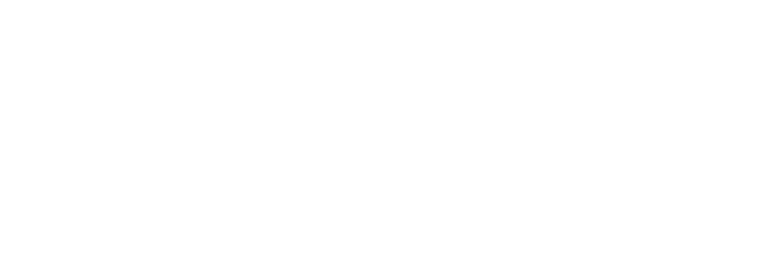Forschung
• Geoarchäologische Rammbohrkernuntersuchung
• Radiokohlenstoffdatierung
• Auswertung von Karten, Satteliten- und Luftbildern, Übertragung in GIS-System
• Paläobotanik
• Paläozoologie
• Geomagnetik, Georadar
• Gezielte Grabungen
Weitere Antworten, besonders zur viel diskutierten Motivation der Landnahme durch die Griechen, versprechen punktuelle Untersuchungen von archäologischen Schlüsselgattungen. Im 4. und 3. Jahrhundert v. Chr. galt das Bosporanische Reich als einer der wichtigsten Getreideexporteure der antiken Welt. Aber seit wann lassen sich tatsächlich exportierfähige Getreidesorten nachweisen? Wenig ist bisher auch darüber bekannt, wie autark die frühen Siedler waren. Welche Materialien fanden sie Vorort, welche mussten sie mitbringen und gegebenenfalls über einen längeren Zeitraum einführen? Keramik kann eine solche Schlüsselgattung zu den angeführten Fragen sein, spiegeln doch Import und lokale Produktion derselben auf unterschiedlichen Skalen über- und regionale Prozesse wider. Das Gleiche gilt etwa auch für Herkunftsuntersuchungen von Reib- und Mahlsteinen zur Getreideverarbeitung.
Letztendlich aber lassen nur magnetische Prospektionen, archäologische Surveys und Ausgrabungen tatsächlich den zeitlichen Rahmen des Landnahmeprozesses bestimmen und Aussagen zum Charakter der Fundstellen zu.
(Taman_3)
(Taman_4)
Im Zuge der geoarchäologisch-paläogeographische Forschung der letzten Jahre konnten die antike Landschaft und der lokale Verlauf des Meeresspiegels im Bereich der Taman-Halbinsel neu untersucht werden. So konnte der Naturraum des Archipels in der Antike rekonstruiert werden. Im laufenden Projekt soll die Landnahme der Griechen auf der östlichen Seite des Bosporus landschafts- und siedlungsarchäologisch bis in die Zeit des Bosporanischen Reichs untersucht werden. Kulturellen und politischen Verschiebungen kommt dabei besondere Aufmerksamkeit zu. In einm breit gefächerten interdisziplinären Ansatz wird der Landschaftsraum in seinen verschiedenen Zeithorizonten rekonstruiert. Naturwissenschaftliche Begleitprogramme sollen versuchen, die Dynamik der regionalen und lokalen Geomorphologie nachzuzeichnen und den Zustand zu rekonstruieren, den die Griechen bei der Landnahme vorfanden.
Getreidereste, Reibsteinen und Keramik sind die Grundlage für Forschungen zur Wirtschaftsweise und möglichen wirtschaftlichen Kontakten. Weitere naturwissenschaftliche Untersuchungen widmen sich der Klimaforschung, der Vegetation sowie den Bodenverhältnissen und dem menschlichen Einfluss darauf. Gezielte geophysikalische Prospektionen sowie archäologische Surveys und Ausgrabungen sollen Aufschluss über die Hierarchie zwischen Hinterland und Polis sowie zwischen den Kolonien geben. Auf Grundlage der Rekonstruktion der Geographie der Region und der siedlungsgeschichtlichen Genese wird analysiert, wie durch die Kolonisation der Griechen politische Räume geschaffen oder neu organisiert wurden.
Durch die Untersuchung von Markierungen, Strukturen und Organisation von Räumen sowie der Strategien der Nutzung von Gebäuden – seien es Heiligtümer, öffentliche Räume, Wohngebiete oder Friedhöfe – lassen sich möglicherweise religiöse, kulturelle und machtpolitische Sphären ausmachen. Eine belastbare Rekonstruktion von Landschaft und gebauter Umwelt verdeutlichen die Gründe der Ortswahl wie auch spätere Veränderungen in der Siedlungskonzeption, letztlich den Ablauf der Kolonisation selbst.
Weitere Antworten, besonders zur viel diskutierten Motivation der Landnahme durch die Griechen, versprechen punktuelle Untersuchungen von archäologischen Schlüsselgattungen. Im 4. und 3. Jahrhundert v. Chr. galt das Bosporanische Reich als einer der wichtigsten Getreideexporteure der antiken Welt. Aber seit wann lassen sich tatsächlich exportierfähige Getreidesorten nachweisen? Wenig ist bisher auch darüber bekannt, wie autark die frühen Siedler waren. Welche Materialien fanden sie Vorort, welche mussten sie mitbringen und gegebenenfalls über einen längeren Zeitraum einführen? Keramik kann eine solche Schlüsselgattung zu den angeführten Fragen sein, spiegeln doch Import und lokale Produktion derselben auf unterschiedlichen Skalen über- und regionale Prozesse wider. Das Gleiche gilt etwa auch für Herkunftsuntersuchungen von Reib- und Mahlsteinen zur Getreideverarbeitung.
Letztendlich aber lassen nur magnetische Prospektionen, archäologische Surveys und Ausgrabungen tatsächlich den zeitlichen Rahmen des Landnahmeprozesses bestimmen und Aussagen zum Charakter der Fundstellen zu.
(Taman_3)
(Taman_4)