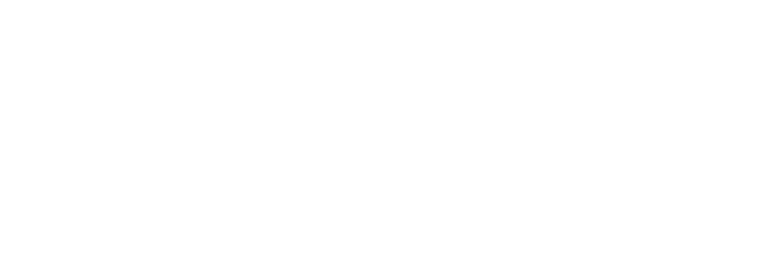Forschung
Hinzu kamen zwei archäologische Prospektionskampagnen außerhalb der befestigten Siedlung, die zudem den Anlass für die Entwicklung von zwei Teilprojekte ergaben. Das eine hatte die Archäometallurgie zum Thema, das andere -›Archeostraits‹- die Geoarchäologie.
Das von D. Marzoli und Pierre Moret geleitete Projekt Archeostraits‹ (2015-2018) wurde von der Deutschen Forschungsgemeinschaft (DFG, Bonn), der Agence National de la Recherche (ANR, Paris) und dem DAI-Madrid gefördert.
Die Ergebnisse der multidisziplinären Untersuchungen werden 2024 in einer dreibändigen Monographie der Madrider Beiträge vorgelegt, an der sich 44 AutorInnen beteiligen.
Sowohl an den Feldforschungen als auch an den folgenden Auswertungen waren außer der eigentlichen Archäologie verschiedene Disziplinen beteiligt: Geologie, Mineralogie, Metallurgie, Geographie, Geophysik, Topographie, Botanik, Zoologie, Chemie, Astronomie, Kernphysik, Statistik, Informatik, Photogrammetrie, Keramikkunde, Numismatik und semitische Philologie. Außerdem arbeiteten Restauratoren, Fotografen und Zeichner. Archäometrische Analysen der Bestandteile der Keramik, der Metalle, Gläser und Steine aus nationalen und internationalen Laboratorien vervollständigen die typologischen Studien der Funde.
Was die naturwissenschaftlichen Keramikanalysen betrifft, so wurden zunächst makroskopische Produktionsgruppen bestimmt. Proben dieser Gruppen wurden anschließend mit der Röntgendiffraktionsmethode untersucht und Dünnschliffe petrografisch mit dem Lichtmikroskop. Außerdem unterzog man die scheibengedrehte phönizische Keramik einer Neutronenaktivierungsanalyse (NAA). Die Fragmente handgemachter Siebgefäße durchsuchte man nach organischen Resten (ORA) und führte eine Bleiisotopenanalyse durch.
Der Klärung der Zusammensetzung der Metallobjekte diente der Einsatz der Röntgenfluoreszenzanalyse (XRF-ED). Die Schlacken dagegen wurden mit einem Rasterelektronenmikroskop (SEM), mit induktiv gekoppelter Magnetfeld-Massenspektrometrie (ICP-SFMS) und der Röntgendiffraktionsmethode (XRD) analysiert.
Geschnittene und geschliffene Steinobjekte bearbeitete man lithologisch und technotypologisch. Detaillierter war die Untersuchung der Mühlsteine. Sie erfolgte einerseits morphologisch, andererseits wurden Gebrauchsspuren an der Oberfläche mit Hilfe der Photogrammetrie aufgespürt und dokumentiert. Eine phytologische Untersuchung der an verschiedenen Reibsteinen und einem großen Steinfragment mit natürlichen Durchlochungen anhaftenden Sedimente vervollständigte diese Untersuchung.
Die Massenspektrometrie mit induktiv gekoppeltem Plasma und Laserablation (LA-ICP-MS) ermöglichte die Untersuchung der Komponenten einer Glasperle.
Die wenigen Münzfunde aus römischer und moderner Zeit wurden numismatisch bearbeitet.
Schon während der Grabungskampagnen existierte ein präventives Konservierungsprotokoll für die Klassifikation, Konservierung und gegebenenfalls auch Restaurierung der Funde, und alle geborgenen Materialien wurden systematisch durch Fotografien und Zeichnungen dokumentiert.
In Aufsätzen, Kongressberichten und Vorträgen wurde von der Projektleiterin und dem Team über den Fortgang der Arbeiten berichtet.