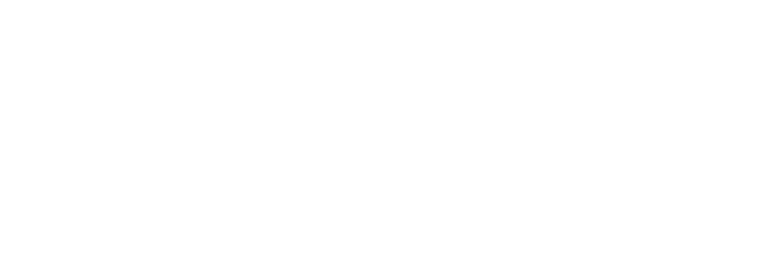Forschung
Durch die archäologische Forschungsliteratur geistert seit nahezu drei Jahrhunderten ein Motiv, für das sich offenbar schwerlich eine einheitliche Benennung finden lässt: Ein nackter, meist geflügelter, angelehnt stehender, kindlicher oder jugendlicher Knabe mit geschlossenen Augen. Der schlummernde Knabe, der mal als Thanatos, mal als Hypnos, Somnus oder Hypnos-Somnus, mal als schlafender Eros, Sleeping Cupid oder Amor funéraire, mal als Todes-/Trauergenius oder Eros-Thanatos bezeichnet wird, transportiert offenbar Bildinformationen, die etwas mit Liebe (gr. Eros, lat. Amor/Cupido), Schlaf (gr. Hypnos, lat. Somnus) und Tod (gr. Thanatos) zu tun haben.
Vor allem in der römischen Plastik des 2. Jh. n. Chr. erfreute sich das Motiv, einerseits in Grabkontexten, anderseits in Wohn- bzw. Villenkontexten scheinbar großer Beliebtheit: Die schlummernden Knaben finden sich in nahezu allen Gattungen – auf Grabstelen, Urnen oder Sarkophagen, als Tischbeine, auf Trinkgeschirr, Lampen, Gemmen und Münzen. Wer ist nun dieser Knabe und was macht ihn so vielfältig einsetzbar?
Das Dissertationsprojekt beschäftigt sich mit dem hermeneutischen Problem der sogenannten Todesgenien und den Wechselbeziehungen zwischen Eros, Hypnos und Thanatos in bildlicher und schriftlicher Überlieferung. Ausgehend von der Hypothese, dass sich im Bildschema des sogenannten Todesgenius Analogien zwischen Eros (Liebe), Hypnos (Schlaf) und Thanatos (Tod) manifestieren, wird in der Arbeit zum einen die Ikonografie des Todesgenius genau untersucht, zum anderen überprüft, welche Bezüge zwischen den Imaginationen der drei daimonoi in den antiken Schriftquellen bestanden. Anhand von Fallbeispielen und unter Berücksichtigung der überlieferten Kontexte wird versucht, der Bedeutung des von den Römern rege rezipierten Bildthemas näher zu kommen und dabei gleichzeitig die bisherige wissenschaftliche Auseinandersetzung mit dem Motiv kritisch zu reflektieren. Das Sujet ‚Todesgenius’ stellt ein Paradebeispiel für die Transformation von Bedeutung und Funktion antiker Motivik dar – sowohl im Hinblick auf den Umgang mit griechischen Themen in der römischen Bildwelt als auch im Hinblick auf die wissenschaftliche Auseinandersetzung mit hybriden Bildern im Laufe der Geschichte.