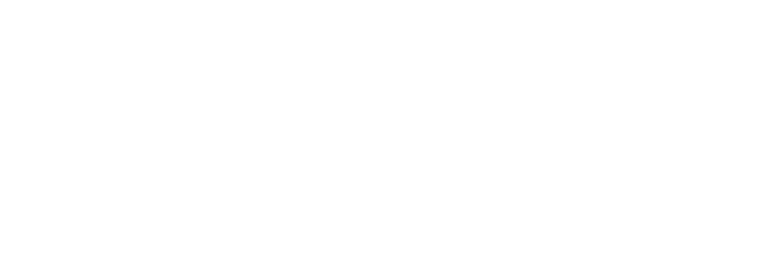Forschung
Das Projekt zur Siedlungsgenese von Albano Laziale wird unter Beteiligung lokaler Institutionen und in Zusammenarbeit mit verschiedenen Hochschulen durchgeführt. Die geschilderten Fragestellungen werden durch die Kombination von siedlungsarchäologischen Methoden (geophysikalische Prospektion, Ausgrabung, Survey, Archäobotanik und -zoologie) und die Bauaufnahme mittels 3D-Laserscanning und Fotogrammetrie, sowie unter Einbeziehung von Nachwuchswissenschaftlern beantwortet.
Das Lager der legio II Parthica in Albano Laziale besitzt als einziges monumentales Legionslager auf italischem Boden besondere Bedeutung. Die Errichtung einer solchen Anlage in Entfernung nur eines halben Tagesmarsches zur Hauptstadt des Reiches bildete wegen der dortigen Stationierung von etwa 5.000 regulären Soldaten einen Traditionsbruch, der bislang nicht hinlänglich untersucht wurde. Trotz seiner Nähe zu Rom, den besonders guten Erhaltungsbedingungen einzelner Bauabschnitte (Umfassungsmauer mit porta praetoria und porta principalis sinistra, Lagerbad, Zisterne), der reichen historischen Überlieferung zur im Lager stationierten Truppe und der Zugehörigkeit des Areals zur Domitiansvilla von Castel Gandolfo wurde dem Platz weder von Seiten der provinzialrömischen Archäologie noch von Seiten der klassischen Archäologie die verdiente Aufmerksamkeit gewidmet. Es ist zudem seit Langem bekannt, das Lager auf dem Gelände der kaiserlichen Villa errichtet wurde, die Domizian im 1. Jahrhundert errichten ließ und deren Areal sich vom nahe gelegen Castel Gandolfo bis nach Albano erstreckte. Die Funktion der in Albano liegenden domizianischen Bauten innerhalb des Villengrundes wurde jedoch bis zum Beginn des Projektes ebenso wenig untersucht, wie die Infrastruktur und Nutzung des gesamten Geländes. Im 18. und 19. Jahrhundert hatten G. B. Piranesi, C. Labruzzi und andere die gut erhaltenen Bauabschnitte der castra Albana zwar in Stichen und Skizzen dokumentiert, eine erste umfassende Aufnahme der Befunde erfolgte aber erst zu Beginn des 20. Jahrhunderts durch G. Lugli und I. Gismondi, die auch den ersten Gesamtplan des Lagers publizierten. In einigen Bereichen des Lagerareals, so etwa an der Westecke der Umfassungsmauer, konnte Lugli seinerzeit zwei Bauphasen beobachten, deren Reste Aufschluss über die Gestalt und frühere Nutzung des Areals in domitianischer Zeit geben könnten, doch wurde ihr Zusammenhang in der jüngeren Forschung nicht weiter geprüft. Seit der überblicksartig angelegten, auf Lugli gestützten Publikation von Edoardo Tortorici zu den archäologischen Befunden von Albano Laziale hat die Anlage keine zusammenfassende Bearbeitung mehr erfahren. Tortorici berücksichtigt jedoch weder alle überlieferten Archivalien zum Lager, noch geht er in seiner Publikation genauer auf die chronologischen und funktionalen Zusammenhänge der Bauten ein oder beschreibt die bauliche Entwicklung des Geländes.
Die zahlreichen Notgrabungen, die in den letzten drei Jahrzehnten in verschiedenen Bereichen des ehemaligen Lagerareals durchgeführt wurden, wurden in der Regel ausschließlich in kurzen Grabungsberichten vorgestellt. Eine systematische Auswertung dieser Aktivitäten fehlte bis zum Projektbeginn ebenso wie eine vollständige Zusammenstellung und Interpretation sämtlicher Archivalien zu den castra Albana.
Das seit 2009 laufende, DFG-geförderte Projekt zielt darauf ab, die Siedlungsgenese von Albano Laziale von republikanischer Zeit bis ins Frühmittelalter nachzuvollziehen und die Abhängigkeiten zwischen den einzelnen Siedlungs- und Nutzungsphasen herauszuarbeiten. Während der Schwerpunkt im ersten Projektabschnitt in der Erforschung der Kaiservilla, des Lagers der Legio II Parthica und seines Umfeldes lag und sich vor allem auf den unmittelbaren Bereich des Lagers selbst konzentrierte, werden der zeitliche und räumliche Rahmen in der Fortsetzung der Untersuchung (2013–2015) weiter gespannt und die bisherigen Erkenntnisse zur Struktur der kaiserlichen Villenanlage und zur Nutzungsdauer des Lagers vertieft. Die intensive Beschäftigung mit dem Legionslager und den Bauten der kaiserlichen Villa haben nämlich gezeigt, dass beide Nutzungsphasen nicht nur in starker Abhängigkeit zueinander standen, sondern auch in Abhängigkeit von der bereits bestehenden republikanischen Bebauung zu sehen sind. So definierten die großen Villenanlagen und die an der Via Appia gelegenen Grabmonumente aus republikanischer Zeit nicht nur die Ausdehnung des kaiserlichen Villenareals, sondern gaben gleichsam den Raum für das severische Legionslager und die zugehörigen canabae legionis vor, die sich auf dem Villenareal entwickelten.
Die beiden severischen Siedlungsbereiche bildeten wiederum die Grundvoraussetzung für die konstantinischen Schenkungen, die im Liber Pontificalis für die Zeit von Papst Silvester überliefert sind (Lib. Pont. 1, 185) und die Erhebung Albanos zum Sitz der Diözese. Die eng miteinander verwobenen Siedlungsphasen beeinflussen damit die Geschichte und Entwicklung der Stadt bis heute, so dass ihre Erforschung einen wichtigen Beitrag zum Verständnis der Stadtentwicklung leisten kann. Neben der dargestellten übergeordneten Fragestellung werden im Rahmen des zweiten Projektabschnitts ausgewählte bauliche und strukturelle Details des Lagers und des kaiserlichen Villenareals untersucht. Aufgrund der besonderen Erhaltungsbedingungen stellen die Befunde in Albano nämlich einen bedeutenden Referenzpunkt für die Erforschung römischer Militär- und Herrschaftsarchitektur, aber auch für den strukturellen und gesellschaftlichen Wandel, die Transformation eines Siedlungsraumes von der Antike zum Mittelalter dar.