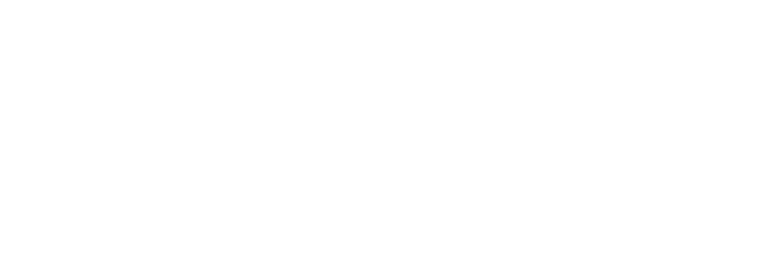Ergebnisse
Mit der archäologischen Untersuchung der Doppelgrabanlage, der Betrachtung ihres topografischen sowie (kultur-)historischen Kontextes, der Aufnahme ihrer Architektur und schließlich der Auswertung des ehemaligen Dekorationsprogramms wird ein außergewöhnliches Grabmonument der thebanischen Nekropole umfassend erforscht. Damit wird ein wichtiger Beitrag zur Untersuchung der thebanischen Grab- und Nekropolenentwicklung geleistet, der unsere Kenntnis von Grabsemantik, Bestattungspraxis und -religion des ausgehenden Neuen Reiches erheblich erweitert. Aus den vielschichtigen Informationen, die sich aus den Grabungsbefunden ableiten lassen, lässt sich ein dichtes Bild der Nutzungsgeschichte des Grabkomplexes entwerfen und an einigen Punkten erhalten wir Einblick in die einflussnehmenden historischen Prozesse.
Beide Gräber sind zu Beginn der 18. Dynastie angelegt worden und verschiedene Beobachtungen lassen darauf schließen, dass sie ursprünglich für König Amenophis I. und seine Mutter Ahmes-Nefertari vorgesehen waren. Ramsesnacht und Amenophis haben mit K93.11/K93.12 also einen der bedeutendsten Plätze in Dra’ Abu el-Naga – im “Großen Vorhof des Amun”, wie dieses Gebiet gegenüber dem Karnak-Tempel im Neuen Reich bezeichnet wurde – für ihr besonderes Konzept eines Grabtempelkomplexes gewählt, der mit seiner gänzlich auf die Festritualistik zugeschnittenen Architektur ein Novum darstellt. Seine außergewöhnlichen baulichen und konzeptuellen Merkmale ergänzen unser Bild der ramessidischen Grabarchitekur: ein von religiösen Szenen dominiertes Bildprogramm, Hathorsäulen (die zuvor einzig in Tempeln zu finden waren), insgesamt vier Säulenhöfe, ein jeweils von zwei Pylonen flankiertes Zwei-Achsen-System (Ost-West- plus Nord-Süd-Achse) und ein über 7 Meter breiter, rund 60 Meter langer Prozessionsaufweg mit unterem Torbau. Das durch den Aufweg von Süden entstehende Zwei-Achsen-Layout hat vermutlich auf ein bereits vorhandenes System zurückgegriffen, denn dem archäologischen Befund unterhalb der ramessidischen Bodenschüttungen zufolge ist der Zugang zur Hofterrasse auch vor der 20. Dynastie von Süden erfolgt. Ein Blick auf die Ausrichtung des nahegelegenen Tempels Men-iset im Fruchtland illustriert zudem eine Verbindung zur Doppelgrabanlage, die in dieser Form schon in der 18. Dynastie existiert hat bzw. bewusst hergestellt worden ist: nämlich zwischen Grab und Tempel Amenophis’ I. und Ahmes-Nefertaris. Ramsesnacht hat den vorhandenen Bezug, vielleicht sogar eine bereits existierende Infrastruktur (Pfad, Prozessionsweg o. ä.) monumentalisiert und rituell neu definiert: Einige der in K93.11 geborgenen Relieffragmente deuten darauf hin, dass im inneren Hof ein Wandkultbild und somit eine Opferstelle für den vergöttlichten Amenophis I. existiert hat. Betrachtet man den substanziellen, mehrfach erneuerten Prozessionsaufweg kann hier vielleicht eine – ebenfalls im Dekorationsprogramm abgebildete – Sänftenprozession mit den Kultbildern des vergöttlichten Königspaares zwischen Men-iset oder auch einem weiteren Heiligtum Amenophis’ I. rekonstruiert werden, nämlich dem “Haus des Amenophis vom Vorhof”. Auf Basis der Architektur und der Ausrichtung der Anlagen läßt sich also ein Teil des Talfestgeschehens in Dra’ Abu el-Naga rekonstruieren.
Darüber hinaus stellen K93.11 und K93.12 mit ihrem ausgereiften Tempelcharakter ein entwicklungsgeschichtliches Bindeglied zwischen der typischen ramessidischen Grabanlage und den monumentalen spätzeitlichen Grabkomplexen in der circa 1 Kilometer südlich gelegenen Ebene des Asasif dar. Die rund 450 Jahre jüngeren Grabtempel im Asasif bilden den lokalen Höhepunkt einer Entwicklung der Grabarchitektur, die bereits in der fortgeschrittenen 18. Dynastie eingesetzt hat und in der Ramessidenzeit zur vollen Entfaltung gekommen ist, nämlich der sogenannten “Sakralisierung des Grabes” (Jan Assmann). Im Zuge dieser Entwicklung übernimmt das Grab Idee und Gestalt und damit auch die Funktion eines Tempels; es wird zu einem Ort, an dem die Verstorbenen mit den Göttern kommunizieren und in ihre Mitte aufgenommen werden können. Die Herstellung von Gottesnähe wird also zum zentralen Instrument für die Fortexistenz im Jenseits.
Neben den religionshistorischen Informationen liefert der archäologische und materielle Befund auch Einblicke in die sozio-ökonomische und politische Lage im ausgehenden Neuen Reich (um 1070 v. Chr.): Die unterschiedliche Ausführung von Relief und Bauelementen bei Ramsesnacht und Amenophis zeigen ein deutliches Qualitätsgefälle, was auf den wirtschaftlichen Niedergang im Verlauf der 20. Dynastie zurückzuführen ist. Interessant ist auch der flächendeckende Zerstörungsbefund, denn beide priesterlichen Monumenten sind am Ende des Neuen Reiches im Zuge politischer Unruhen in Theben zerstört worden.
Trotz der Zerstörung der ramessidischen Grabtempel hat sich die Nutzung als Bestattungsplatz noch bis in die 25. Dynastie (um 700 v. Chr.) hinein fortgesetzt, was darauf hinweist, dass die Doppelgrabanlage ihre Bedeutung als heiliger Ort und Orientierungspunkt in der religiösen Landschaft nicht verloren hatte. Dies und nicht zuletzt auch die einfache Zugänglichkeit über den alten Aufweg – dessen Stratigrafie eine Benutzung bis in koptische Zeit und darüber hinaus aufzeigt – sind Faktoren, die die verschiedenen Nutzungen über die Jahrhunderte erleichtert und motiviert haben. Für die koptische Besiedlung hatte der pharaonenzeitliche Ort seine religiöse Sinnhaftigkeit natürlich verloren. Er erschien den Mönchen des benachbarten Paulosklosters jedoch unter funktionalen Gesichtspunkten ideal für die Errichtung ihrer Wirtschaftsanlagen.
Publikationen:
S. Michels, Cult and funerary pottery from the tomb-temple K93.12 at the end of the 20th dynasty (Dra‘ Abu el-Naga/Western Thebes), in: B. Bader/ Chr. M. Knoblauch/E. Chr. Köhler (Hrsg.),Vienna 2 – Ancient Egyptian Ceramics in the 21st Century. Proceedings of the International Conference held at the University of Vienna 14th–18th of May 2012, OLA 245 (Leuven 2016) 403‒421.
D. Polz, Dra’ Abu el-Naga V: Stelen und Stelenfragmente aus Dra’ Abu el-Naga (in Vorbereitung).
U. Rummel, Dra’ Abu el-Naga IV: Bilder, Skizzen, Zeichnungen. Die figürlichen Ostraka aus Dra’ Abu el-Naga, AV 132 (in Vorbereitung).
U. Rummel, Die Wirtschaftsanlagen des Paulosklosters (Deir el-Bachît) in der Doppelgrabanlage K93.1/K93.12 in Dra‘ Abu el-Naga, in: I. Eichner/D. Polz (Hrsg.), Das Pauloskloster in den Bergen von Djeme. Eine Mönchsgemeinschaft am Rande der Wüste, SDAIK 44 (im Druck).
U. Rummel, Landscape, tombs, and sanctuaries: the interaction of architecture and topography in Western Thebes, in: C. Geisen (ed.), Proceedings of the International Conference “Ritual Landscape and Performance”, Yale University, September 23rd to 24th, 2016, Yale Egyptological Studies 13 (New Haven 2020) 89–119.
U. Rummel, in: M. Eldamaty/M. Trad (Hrsg.), Egyptian Museum Collections around the World. Studies for the Centennial of the Egyptian Museum, Cairo (Kairo 2002) 1025–1034.
A. J. Veldmeijer, Leatherwork from Dra Abu el-Naga: Some First Observations – Archaeological Leather Group Newsletter 36, 2012, 9–11.
A. Zink/S. Lösch, Paläoepidemiologie und Mumienforschung, in: A. Wieczorek et al., Mumien – Der Traum vom ewigen Leben (Mainz 2015) 237–243.
Downloads
eFB2015-2_Rummel_DraAbuEl-Naga (pdf)
DAN Arbeitsbericht 2011 (pdf) Bericht über die Arbeiten der Herbstkampagne 2011 in der Doppelgrabanlage K93.11/K93.12
eFB14-2 Rummel_DraAbuElNaga.pdf (pdf)
DAN Arbeitsbericht 2012 (pdf) Bericht über die Arbeiten der Herbstkampagne 2012 in der Doppelgrabanlage K93.11/K93.12
DAN Arbeitsbericht 2014 (pdf) Bericht über die Arbeiten der Frühjahrskampagne 2014 in der Doppelgrabanlage K93.11/K93.12 in Dra' Abu el-Naga