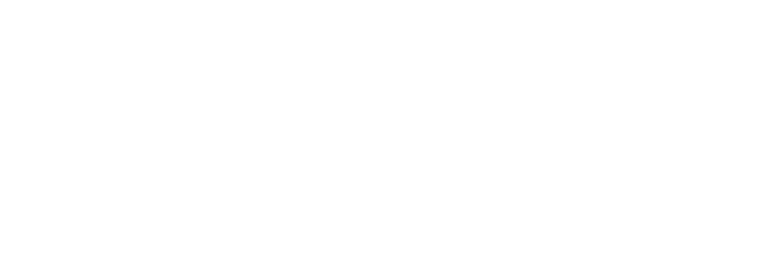Überblick
Befestigungen werden oft lediglich als Schutzbauten begriffen, gelten kaum als ästhetische Monumente und wurden häufig nur unter wehrtechnischen Aspekten erforscht. Doch besitzen sie meist weit darüberhinausgehende symbolische Bedeutungen, kommunizieren über den vordergründigen Wehrcharakter noch wichtige Botschaften an den Betrachter, die bisher nicht ausreichend untersucht wurden. Diese gilt es – basierend auf einer neueren Symboltheorie der Architektur – eingehend zu analysieren und damit die bedeutende gesellschaftliche Rolle griechischer und römischer Wehrbauten herauszuarbeiten. Durch ästhetische Gestaltung, monumentale Inszenierung, Spolienverbau oder Inschriften können Befestigungen von Reichtum und Macht der Erbauer, aber auch von Unabhängigkeit, Identität, Traditionen, Loyalitäten und privatem Stifterstolz künden oder als historische, öffentliche und sakrale Monumente dienen. Solche symbolischen Funktionen sind hinsichtlich ihrer Identifizierbarkeit, Unterscheidung von und Überlappung mit praktischen Funktionen, ihrer Ausdrucksformen, Aussagen und Abhängigkeiten von politischen und gesellschaftlichen Bedingungen sowie ihrer generellen Wandelbarkeit im regionalen, politischen und chronologischen Horizont der Antike zu untersuchen. Die Wahrnehmung antiker Befestigungen wird damit von ihrer Wehrfunktion erweitert auf ihre Rolle als bewusst konzipierte Elemente gebauten Raums, Spiegel gesellschaftlichen Selbstbewusstseins und Träger aussagekräftiger Botschaften.