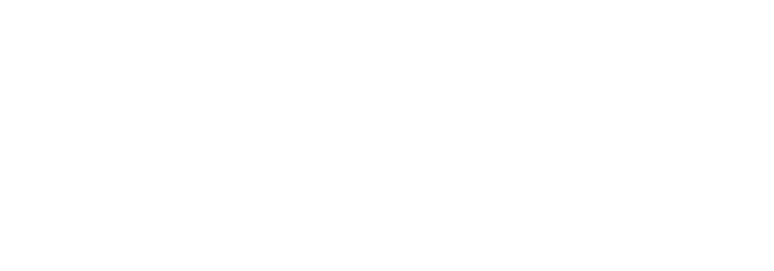Ergebnisse
Erste Ergebnisse
Schon in der geometrischen Epoche stachen Stadtmauern nicht nur durch ihre monumentalen Dimensionen, sondern auch durch außergewöhnliche Präzision und bewusste Ästhetik in der Ausarbeitung nach außen wie nach innen hervor, wodurch klar über die Wehrfunktion hinausgehende Absichten erkennbar sind. Auch Farbeffekte sowie dekorative Mauerwerksformen wurden schon in diesen frühen Zeiten mithilfe gezielter und aufwändiger Materialwahl eingesetzt.
In klassischer Zeit ist zunächst die gezielte Spolienverwendung als Beispiel einer symbolischen Funktion von Befestigungen als historische Monumente zu nennen, weiterhin wurden mächtige, durch ihre Ausführungsqualität herausragende Stadtmauern als Zeichen kolonialer Macht eingesetzt. Schon früh zeigten sich repräsentative Bedeutungen auch in der dichten Reihung von Türmen in stark frequentierten Bereichen, ohne dass dafür eine fortifikatorische Notwendigkeit bestand, die schmuckhafte Ausführung von Kurtinen in Torbereichen und die Verwendung von dekorativen Elementen an Toren und später auch Wasserdurchlässen. Konzertierte Aktionen von Bauprozessen konnten zudem identitätsstiftende Funktionen übernehmen.
In der hellenistischer Epoche wurden zunächst durch die Erfindung von Torsions-Katapultgeschützen unter Alexander dem Großen neue Maßstäbe auch für die Defensivarchitektur gesetzt, die mit teils immens gesteigerten Dimensionen der Mauern und Türme oder auch Vorwerken darauf reagiert, wobei sich in landschaftlichen Inszenierungen, Überdimensionierungen und der Multiplikation von Wehrelementen auch klare symbolischen Aspekte zeigen. Repräsentative Zwecke von Befestigungen scheinen im Hellenismus stärker zum allgemeinen Phänomen zu werden, was sich durch die veränderte Herrschaftsstruktur, häufige Machtkämpfe und Machtwechsel erklären lässt und mit der generellen Entwicklung der meist von Herrscherhöfen ausgehenden Repräsentationsarchitektur zusammengeht. Symptomatisch für diese Entwicklung ist die Verbreitung der Darstellung der Stadttyche. In der fortschreitenden hellenistischen Periode sucht die Befestigungstaktik immer weniger in ausgedehnten Verläufen, sondern eher durch gesteigerte Verteidigungstechnik auf kürzeren Mauern zu schützen, ebenso scheinen sich symbolische Absichten weg von der groß angelegten Landschaftsinszenierung mehr zu Ausführungsqualität einzelner Abschnitte oder Elemente hin zu verlagern. Es entstehen erstmals auch Stadtbefestigungen, deren fortifikatorischer Wert deutlich hinter ihrem ästhetischen Anspruch zurücktritt und die mehr als Symbole städtischer Lebensqualität denn als Wehrbauten fungierten. Architekturdekor wie Reliefs und Friese erhalten mehr und mehr Einzug in die Befestigungsarchitektur und Festungen beginnen, der privaten Herrscher- oder Oberschichtsrepräsentation zu dienen.
Zur Zeit der römischen Republik bediente sich die Befestigungsarchitektur ähnlicher formaler und symbolischer Elemente wie die griechische Kultur. Mit den Koloniegründungen durch Rom begannen sich symbolische Funktionen von Befestigungen aber auch gezielt durch die Verwendung von in der jeweiligen regionalen Architektur nicht gebräuchlichen Formen zu manifestieren. In der besonderen politischen Situation der Kaiserzeit während der pax Romana entstand ein ganz besonderes Phänomen: bei den zu dieser Zeit errichteten Stadtbefestigungen Italiens sind vorwiegend symbolische Funktionen vorauszusetzen, da hier die Notwendigkeit der Verteidigung nicht mehr gegeben war. Überhaupt erst unter diesen speziellen politischen Bedingungen denkbar und als reine Symbole von Stadtkultur oder Status sind Stadtmauern oder ihr entlehnte Einzelelemente zu begreifen, die keinen geschlossenen Ring um die Stadt bildeten oder deren Elemente bewusst als nicht verteidigungsfähig konzipiert wurden. Schon bei den frühsten Befestigungen sind generell vor allem die Toranlagen Orte, an denen sich durch ihre oft schmuckhafte Ausgestaltung repräsentativ-symbolische Funktionen manifestieren, z.B. seit der frühen Kaiserzeit durch die geräumige Anlage an sich, die kanonische Reihung von mehreren Portalen, Arkadengalerien über den Toren und weitere ästhetische Verfeinerungen wie Profile, Gesimse, akzentuierte Architrave oder Pilaster. Schon im 1. Jh. n. Chr. taucht ein neues dekoratives Element im Befestigungsbau auf, das in der späten Kaiserzeit erst wieder aufgegriffen wird, nämlich die Verzierung des Mauerwerks von Türmen und Kurtinen mit mosaikartigen Mustern.
Mit dem Ende der pax Romana und den verstärkten Angriffen auf die Grenzen des Römischen Reiches sind symbolische Botschaften an Befestigungen wieder vermehrt an der Betonung von der Wehrkraft dienlichen Elementen ablesbar, z.B. über die Überdimensionierung von Türmen und Kurtinen oder die übertrieben dichte Reihung von Türmen. Es zeigt sich generell im gesamten Horizont antiker Befestigungen, dass nur in längeren Friedenszeiten symbolische Funktionen verstärkt über Ornamentik und ästhetische Gestaltung ausgedrückt wurden. Solange Befestigungen aber eine aktive Wehrfunktion besaßen, wurde vor allem mithilfe von Elementen repräsentiert, die gleichzeitig auch die Wehrkraft steigerten und eine abschreckende Wirkung auf den Feind ausübten.
Publikationen
- S. Müth – A. Sokolicek – B. Jansen – E. Laufer, Chapter 1. Methods of Interpretation, in: S. Müth – P. I. Schneider – M. Schnelle – P. DeStaebler (Hrsg.), Ancient Fortifications: A compendium of theory and practice, Fokus Fortifikation Studies 1 (Oxford 2016) 1-23
li>
- C. Brasse – S. Müth, Chapter 5. Mauerwerksformen und Mauerwerkstechniken, in: S. Müth – P. I. Schneider – M. Schnelle – P. DeStaebler (Hrsg.), Ancient Fortifications: A compendium of theory and practice, Fokus Fortifikation Studies 1 (Oxford 2016) 75-100
- S. Müth – E. Laufer – C. Brasse, Chapter 7. Symbolische Funktionen, in: S. Müth – P. I. Schneider – M. Schnelle – P. DeStaebler (Hrsg.), Ancient Fortifications: A compendium of theory and practice, Fokus Fortifikation Studies 1 (Oxford 2016) 126-58
- S. Müth, Chapter 8. Urbanistic Functions and Aspects, in: S. Müth – P. I. Schneider – M. Schnelle – P. DeStaebler (Hrsg.), Ancient Fortifications: A compendium of theory and practice, Fokus Fortifikation Studies 1 (Oxford 2016) 159-72
- R. Frederiksen – E. Laufer – S. Müth, Chapter 9. Source Criticism: Fortifications in the written sources and the visual arts, in: S. Müth – P. I. Schneider – M. Schnelle – P. DeStaebler (Hrsg.), Ancient Fortifications: A compendium of theory and practice, Fokus Fortifikation Studies 1 (Oxford 2016) 173-95
- S. Müth – U. Ruppe, Chapter 12. Regional begrenzte Phänomene, in: S. Müth – P. I. Schneider – M. Schnelle – P. DeStaebler (Hrsg.), Ancient Fortifications: A compendium of theory and practice, Fokus Fortifikation Studies 1 (Oxford 2016) 231-48
- S. Müth, Functions and Semantics of Fortifications: An introduction, in: R. Frederiksen - S. Müth – P. Schneider – M. Schnelle (Hrsg.), Focus on Fortification: New research on fortifications in the Ancient Mediterranean and the Near East. Papers of the conference on the Research of Ancient Fortifications, Athens 6-9 December 2012, Fokus Fortifikation Studies 2, Monograph of the Danish Institute at Athens 18 (Oxford 2016) 183-92
- S. Müth, Regionally confined Phenomena: Introduction to Session 6, in: R. Frederiksen - S. Müth – P. Schneider – M. Schnelle (Hrsg.), Focus on Fortification: New research on fortifications in the Ancient Mediterranean and the Near East. Papers of the conference on the Research of Ancient Fortifications, Athens 6-9 December 2012, Fokus Fortifikation Studies 2, Monograph of the Danish Institute at Athens 18 (Oxford 2016) 517-8
- S. Müth, More than War: symbolic functions of Greek fortifications, in: P. Sapirstein – D. Scahill (Hrsg.), New directions and paradigms for the study of Greek architecture: interdisciplinary dialogues in the field, Monumenta Graeca et Romana 25 (Leiden 2020) 199-214
- S. Müth, Strategy versus Representation? The late Classical city wall of Messene, in: M. Eisenberg & R. Khamisy (eds.), The Art of Siege Warfare and Military Architecture from the Classical World to the Middle Ages (Oxford 2021) 21-31
- S. Müth, Fortifications, in: W. Heckel – F.S. Naiden – E.E. Garvin – J. Vanderspoel (Hrsg.), A Companion to Greek Warfare (Hoboken, NJ 2021) 241-251