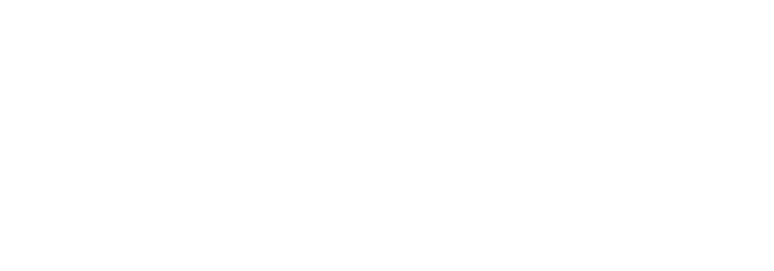Ergebnisse
Mit den Bleiisotopenanalysen wurden erstmals Messergebnisse aus dem Sinai vorgelegt, die mit Probenserien von Fundkomplexen anderer Regionen verglichen werden konnten (Lagerstätten in Jordanien, Israel/Palästina sowie Saudi-Arabien, Fundplätze Maadi (Unterägypten) und Tall al-Magass, Tall Hujayrat al-Ghuzlan (Südjordanien)). Die Isotopendaten konnte veranschaulichen, dass der Sinai als Rohstoffquelle für einige Metallfunde, unter anderem in Maadi (Material aus den Neugrabungen), nicht ausgeschlossen werden kann. Dies würde bedeuten, dass Maadi - wo bisher keine Spuren extraktiver Metallurgie gefunden wurden - zu Teilen mit aus Sinai-Erzen gefertigtem Kupfer versorgt wurde. Zudem konnten weitere Ergebnisse zur Besiedlung, der Chronologie und antiken Verbindungsrouten gewonnen werden. Ältere Datierungen von Fundplätzen früherer Surveys erbrachten überdurchschnittlich viele Einordnungen in die FBZ II, während noch ältere Perioden trotz passendem Fundmaterial nicht erwähnt wurden. Dies bot die Möglichkeit zur Korrektur der Chronologie, die sich zunächst am Fundmaterial orientiert (Lithik, Muschelartefakte, Felsgesteingeräte). Daraus resultierte, dass mindestens 30 Plätze vor der FBZ II bestanden, und bis in die Mitte des 5. Jts. v. Chr. zurückreichen.
Eine bisher lang angenommene These der Einphasigkeit der meisten Fundorte wird zunehmend entkräftet, denn Fundmaterial aus unterschiedlichen Perioden sowie stratigrafische Beobachtungen indizieren häufig mehrphasige Besiedlung und wiederholtes Aufsuchen der vorhandenen Strukturen. Einige der steinernen Wohnanlagen können sogar ins akeramische Neolithikum (PPNB, 9200-7800 BP) datiert werden. Sie sind durch architektonische Formen gekennzeichnet, die bis in die Spätbronzezeit unverändert geblieben sind, und beinhalten Funde aus unterschiedlichen Perioden. Möglicherweise zeigt sich hier, dass die lokale Bevölkerung die Wiederbenutzung vorhandener Strukturen tradiert hat, was wiederum auf eine Kontinuität in der Besiedlungsgeschichte schließen lässt.
Die lokale Bevölkerung des Sinai bestand in der Prähistorie aus Hirtennomaden, die höchst wahrscheinlich im frühen Kupferbergbau und -handel aktiv waren. Unterschiedliche Analogien zeigen auf, dass auch die Kupferproduktion und der frühe Tauschhandel der Rohmaterialien vorwiegend in der Hand der nomadisch lebenden Bevölkerung gewesen sein könnte. Deren Erschließung des Wüstengebietes war von Wasser abhängig. Anhand von Brunnen, Wasserstellen, Oasen und Quellen lässt sich ein Wegnetz rekonstruieren, welches zum einen die gesamte Halbinsel abdeckt und zum anderen den Überlandweg in kurze Streckenabschnitte gliedert.