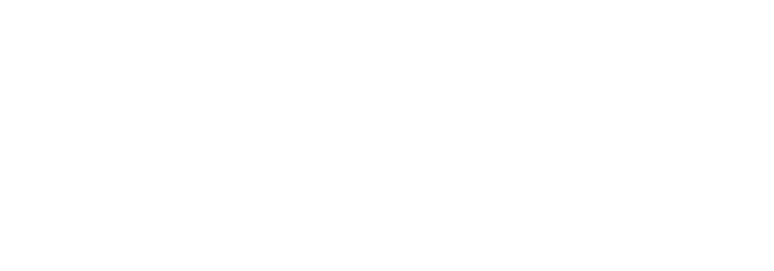Forschung
Mit dem interdisziplinären Forschungsprojekt wurde eine Neubewertung des eher vernachlässigten archäologischen Potenzials im Sinai erzielt. Im Fokus standen dafür Aspekte frühen Erzbergbaus im Sinai und die Funktion der frühen Siedlungen (5./4. Jt. v. Chr.) in der Kupferproduktion. Auch die Erforschung der Innovation Kupfermetallurgie in ihrer Entwicklung und Herkunft in den Gesellschaften des Sinai wurde angestrebt sowie die damit zusammenhängende Erfassung einer Relevanz sinaitischer Kupferproduktion für die Handelsaktivitäten zwischen Ägypten und der Levante im 4. Jt. v. Chr. erzielt. Mit Bleiisotopenanalysen wurden Möglichkeiten geschaffen, in großem Maßstab Provenienzstudien zu betreiben und die in der Südlevante, Unterägypten und dem Sinai vorliegenden Kupferartefakte des 4. Jt. v. Chr. mit den Lagerstätten abzugleichen. Daraus sollten wiederum Hinweise auf den ökonomischen und kulturellen Austausch in der Region gewonnen und auf dieser Basis neue Überlegungen zum Innovationstransfer und zur Technologiegeschichte vorgenommen werden.
Des Weiteren war eine Überarbeitung von geborgenem Fundmaterial aus Ausgrabungen, unter besonderen Gesichtspunkten der Archäometallurgie und der ägyptischen Keramik zu Datierungszwecken, angestrebt. Zur Frage der Datierung und der Funktion im Erzabbau sollten ausgewählte Fundplätze aufgesucht und durch Sondagen und kleinere Ausgrabungen erfasst werden.
W.M. Flinders Petrie und C.T. Currelly begannen 1905/1906 die Prähistorie des Sinai gezielt zu erforschen, dabei standen archäologische, montanarchäologische und geologische Fragestellungen im Vordergrund. Im Jahr 1958 publizierte der Geological Survey of Egypt seine Ergebnisse von den naturwissenschaftlich ausgelegten Begehungen und es erfolgten Kartierungen und Beschreibungen der Lagerstätten und Erzvorkommen. B. Rothenberg (später am Institute for Archaeo-Metallurgical Studies, London) begann 1956 mittels Surveys und Testgrabungen den Sinai systematisch zu untersuchen, seine Forschungsarbeit führte er bis in die 1980er Jahre fort und er dokumentierte mehr als 700 Fundplätze. Zwischen 1971 und 1982 beging I. Beit-Arieh (Universität von Tel Aviv) im Rahmen seiner Ophir Expedition speziell entlang der zentralen Routen des nördlichen, westlichen und insbesondere des südlichen Sinai eine Gesamtfläche von 1700 km², wobei über 300 Fundplätze dokumentiert und sieben ausgegraben wurden. E.D. Oren (Ben-Gurion Universität Beersheva) leitete zwischen 1972-1982 die North Sinai Expedition entlang des Küstenstreifens im Nordsinai, seine Untersuchungen erbrachten neue Erkenntnisse zu den Verbindungen zwischen der Südlevante und Unterägypten. Im östlichen Zentralsinai arbeiteten F.W. Eddy und F. Wendorf (American Research Center in Egypt) im Jahr 1996, sie nahmen 73 Fundplätze auf und es fanden Sondagen und Notgrabungen statt. F. Paris vom «Institut Français d`Archéologie Orientale» (IFAO) leitete seit 1999 Ausgrabungen in der großen Siedlung 'Ain Fogeiya in der zentralwestlichen Region, weitere Fundplätze wurden im Zentralsinai bearbeitet. Seit 2000 leitete G. D. Mumford (Survey and Excavation Projects in Egypt - SEPE) Surveys und Ausgrabungen in der el-Markha Ebene an der südwestlichen Küste.
Das Projekt gliederte sich in unterschiedliche Fachdisziplinen ein, die aus dem Bereich der Altertumswissenschaften (Prähistorische Archäologie, Ägyptologie, Vorderasiatische Archäologie, Montanarchäologie, Archäometallurgie) und dem Bereich der Geowissenschaften stammen (Geologie, Mineralogie, Metallurgie, Archäometrie). Durch das Ineinandergreifen der Fachgebiete wurde ein breites Spektrum an Fragestellungen interdisziplinär abgedeckt. Methodische Herangehensweisen lagen in bleiisotopischen Analyseserien, chemischen Untersuchungen und Spurenelementenanalysen. Fundmaterial aus Altgrabungen und laufenden Projekten wurde gesichtet und Siedlungsstrukturen mit dem Verfahren der Optisch Stimulierten Lumineszenz (OSL) datiert. Grabungen und Sondagen fanden an ausgewählten Fundplätzen statt und prähistorische bergbauliche Spuren wurden erfasst.
Anhand von Wasserstellen und topografischen Kriterien wurden mögliche Verbindungsrouten rekonstruiert, anhand derer die Interaktionen über und innerhalb des Sinais verlaufen sein könnten; dazu standen speziell die Wegesysteme im mittleren und südlichen Sinai im Vordergrund, da die nördlichen Überlandrouten bereits größtenteils als erforscht gelten können.