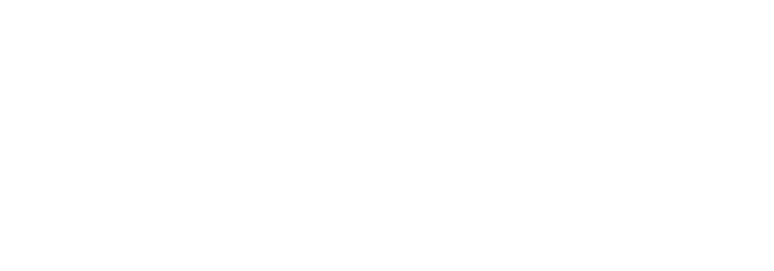Ergebnisse
Nach katalogmäßiger, photographischer und zeichnerischer Aufnahme und detaillierter Untersuchung sämtlicher bislang bekannten Architektur- und Bauskulpturfragmente des Tempels lassen sich folgende vorläufigen Ergebnisse festhalten:
Dem archaischen Apollon-Tempel und seinem Altar kann bislang ein Ensemble von rund 600 zerschlagenen Werkstücken aus der Mitte des 6. Jhs. v. Chr. (ca. 560–540/530) zugewiesen werden, von denen etwa 85 % aus Mergel/Kalkstein und ca. 15 % aus Marmor und gefertigt sind. Die verschiedenen Steinmaterialien wurden ähnlich wie an den beiden Dipteroi im Heraion in Samos nebeneinander am selben Bau verwendet, der Marmor an der Front des Tempels sowie des Naiskos im Adyton eingesetzt.
Die auffallend gute Erhaltung der archaischen Werkstücke spricht für ein systematisches Zerschlagen und ›Bestatten‹ überwiegend unbeschädigter, gelegentlich durch Brand verfärbter Bauglieder in spätklassischer-frühhellenistischer Zeit beim Bau des Nachfolgers und stellt Herodots Überlieferung von der ›Zerstörung‹ des archaischen Tempels in Frage.
Während der Tempel in Bauformen, Material und Technik zunächst vom ersten Dipteros, dem ›Theodoros-Tempel‹, im Heraion in Samos beeinflusst war, wirkten ab 560/550 der untere Tempel in Myus sowie insbesondere das archaische Artemision von Ephesos als Vorbilder.
Neben den wenigstens sieben Gruppen von Säulenschäften erlauben insbesondere die Säulenbasen Rückschlüsse auf den Grundriss des Tempels, der anhand der erhaltenen Fundamentreste der Adytonmauern allein nicht mehr zu klären ist:
Während die Mergel-/Kalksteinsäulen facettierte Wulstbasen und ›Toruskapitelle‹ zeigten, ruhten die Marmorsäulen mit ionischen Volutenkapitellen auf sog. ephesischen Säulenbasen, deren Spirenfragmente fünf Gruppen signifikant verschiedener Größe – von Monumental- bis Miniaturgröße – zugewiesen werden können. Der archaische Tempel wies demnach eine umlaufende Säulenstellung auf, die wenigstens an der Marmorfront dipteral ausgebildet war, einen Pronaos und einen Naiskos sowie mit großer Wahrscheinlichkeit einen ›Zweisäulensaal‹ und nahm damit charakteristische kultbedingte Formen des hellenistischen Tempels vorweg.
Veröffentlichungen
Uta Dirschedl, Die griechischen Säulenbasen, AF 28 (Wiesbaden 2013)
Uta Dirschedl, Der archaische Apollontempel in Didyma. Erste Ergebnisse der Aufarbeitungskampagnen 2003 – 2009, in: Th. Schulz (Hrsg.), Dipteros – Pseudodipteros. Bauhistorische und archäologische Forschungen, Internationale Tagung 13.11. – 15.11.2009 an der Hochschule Regensburg, Byzas 12 (Istanbul 2012) 41–68
– , The Archaic Temple of Apollo at Didyma – a Building Project in Competition with the dipteroi at Samos and Ephesos, in: J. Pakkanen (Hrsg.), Greek Building Projects, International Workshop 23.6. – 25.6.2014 Finnish Institute at Athens [in Vorbereitung]
Vorberichte
Uta Dirschedl, Didyma (Türkei), Archaischer Apollontempel, in: Jahresbericht 2006 des DAI, AA 2007, 22–24
– , Didyma (Türkei), Archaischer Apollontempel, in: Jahresbericht 2007 des DAI, AA 2008, 22–24
– , Didyma (Türkei), Archaischer Apollontempel, in: Jahresbericht 2009 des DAI, AA 2010, 18. 19
– , Didyma (Türkei), Archaischer Apollontempel, in: Jahresbericht 2010 des DAI, AA 2011 Beih., 17–19
– , Didyma (Türkei), Archaischer Apollontempel, in: Jahresbericht 2011 des DAI, AA 2012, Beih. 15–18