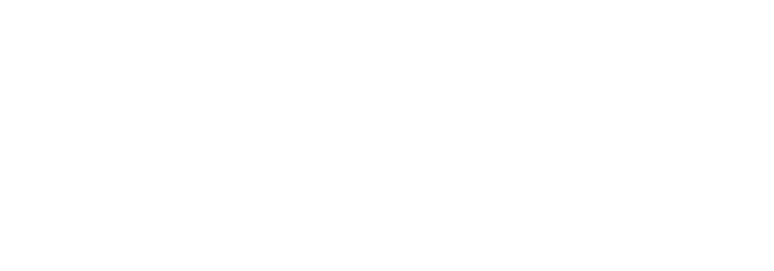Raum & Zeit
Über die regionale und überregionale Bedeutung des »uralten« Orakelheiligtums, »das alle Ionier und Aioler zu befragen pflegten« (Hdt. 1, 157), sind wir für die archaische Zeit durch den im benachbarten karischen Halikarnassos um 480 v. Chr. geborenen Geschichtsschreiber Herodot unterrichtet, der u. a. überliefert, der ägyptische Pharao Necho (610–595 v. Chr.) habe nach dem Sieg in der Schlacht von Megiddo (609/608 v. Chr.) »die Rüstung, in der er diese Eroberung vollbrachte« »zu dem Heiligtum der Branchiden im Gebiet von Milet« geschickt und »ließ sie dem Apollon weihen« (Hdt. 2, 159); des Weiteren habe der Lyderkönig Kroisos (560–547 v. Chr.) goldene Votivgeschenke »denen in Delphi an Gewicht gleich und ähnlich im Aussehen« (Hdt. 1, 92) in das Orakelheiligtum gestiftet, an das der ›orakelgläubige‹ Herrscher sich mehrfach mit Anfragen wandte (Hdt. 1, 46).
Auch über den Untergang des archaischen Heiligtums sind wir durch Herodot unterrichtet: Nach der Einnahme Milets durch die Perser unter König Dareios (494 v. Chr.) sei die Mehrzahl der Männer getötet, Frauen und Kinder zu Sklaven gemacht und »das Heiligtum in Didyma, Tempel sowohl wie Orakelstätte, ausgeplündert und niedergebrannt« (Hdt. 6, 19, 3) worden; die überlebenden gefangenen Milesier habe Dareios nach Susa gebracht und sie in der Stadt Ampe an der Tigrismündung angesiedelt (Hdt. 6, 20).
Auch das von dem Bildhauer Kanachos von Sikyon geschaffene bronzene Götterbild des Apollon (Plin. nat. 34, 75; Paus. 2, 10, 5; 9, 10, 2) raubten die Perser; es sollte erst annähernd zwei Jahrhunderte später von Seleukos I. (358/354–281 v. Chr.) wieder zurücksendet werden (Paus. 1, 16, 3; 8, 46, 3).
Nach Strabon (14, 1, 5; 11, 11, 4; 17, 1, 43) und Pausanias (1, 16, 3) wurde das Heiligtum allerdings erst unter Xerxes auf dem Rückzug der Perser im Jahre 479 v. Chr. heimgesucht (vgl. Plin. nat. 34, 75).
Didyma liegt heute an der türkischen Westküste inmitten des modernen Ortes Didim (nahe dem bekannten, im Sommer von Touristen übervölkerten Badeort Altınkum) – etwa auf halber Strecke zwischen den Städten Izmir und Bodrum, den antiken Städten Smyrna und Halikarnassos – mit Blick auf die wenige Kilometer entfernte griechische Insel Samos.
Das dem Apollon geweihte ›extra-urbane‹ Heiligtum von Didyma liegt im Süden der sog. Milesischen Halbinsel am Golf von Iasos an der Nahtstelle zwischen den antiken Landschaften Ionien und Karien (Strab. 14, 12). In der Antike war es vor der Versandung des bis Herakleia am Latmos reichenden Milesischen Golfes durch den Fluss Mäander von der Hafenstadt Milet auf dem Seeweg über die Anlegestelle Panormos zu erreichen und wurde etwa um die Mitte des 6. Jhs. durch einen ca. 5 bis 7 m breiten, rund 20 km langen, partiell befestigten Weg mit der Stadt Milet und dessen Hauptheiligtum, dem Delphinion, verbunden – einer seit dem 2. Jh. v. Chr. inschriftlich als »ὀδὸς πλατεῖa« (»breiter Weg«) bezeichneten Heiligen Straße für die alljährlichen Prozessionen.
Kultmal und ›Keimzelle‹ des Heiligtums war auf dem verkarsteten wasserarmen Kalksteinplateau von Alters her eine Süßwasserquelle, an der der Kultlegende nach die Titanentochter Leto ihren Sohn Apollon von Zeus empfing.
Die Heilige Quelle wurde als Kultmal über mehr als ein Jahrtausend an derselben Stelle ›hypäthral‹ ,unter freiem Himmel, in drei aufeinanderfolgenden, einander ›ummantelnden‹, zunehmend größeren Höfen verehrt, die ab archaischer Zeit in prächtige, mit reichem Bau- und Skulpturenschmuck ausgestattete Tempel inkorporiert waren.