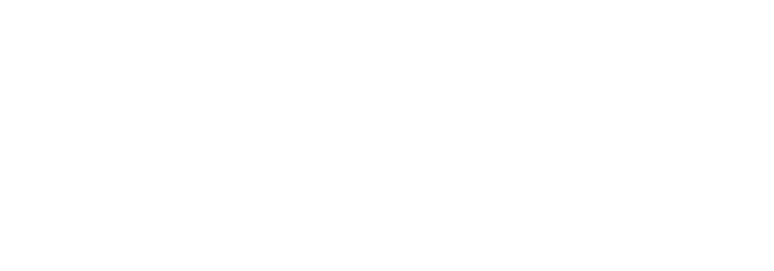Überblick
Die Ebene des Sarno in Kampanien bildet eine uralte Kulturlandschaft, die wegen ihrer besonderen naturräumlichen Vorzüge (geographische Lage, Wasserreichtum, äußerste Fruchtbarkeit des Bodens, günstige Klimabedingungen) spätestens seit der Bronzezeit von Menschen verschiedener Kulturen intensiv und kontinuierlich besiedelt wurde. Die Landschaft ist durch das häufige Auftreten von Naturereignissen (Vulkantätigkeit, Erdbebentätigkeit, Bradyseismus, hohe Sedimentierung) einem starken Transformationsprozess unterworfen, der durch anthropogene Einwirkungen (Abholzung, Trockenlegung, Landnutzung) noch potenziert wurde, und der zuletzt durch die moderne Urbanisierung der Ebene in dramatischer Weise beschleunigt wird. Die Lebensbedingungen in der Region sind also in besonderer Weise durch den Überfluss an natürlichen Ressourcen einerseits und die andauernde Bedrohung durch die Naturkatastrophen andererseits geprägt. Das Forschungsvorhaben nimmt sich vor, die Lebensverhältnisse des Menschen in der Antike in der Sarno-Ebene unter diesen ambivalenten Umweltbedingungen zu untersuchen und nach dem jeweiligen Siedlungsverhalten der sozialen Gemeinschaften im landschaftlichen Großraum über verschiedene Epochen hin zu fragen. Unter diesen umweltarchäologischen Aspekten werden die verschiedenen Siedlungsaktivitäten großräumlich klassifiziert, die Wechselbeziehungen der Siedlungen untereinander und in ihrer Abhängigkeit von den naturräumlichen Gegebenheiten analysiert. Eine wesentliche Rolle spielen dabei Fragen der paläoökologischen Genese der Landschaft des Sarno-Beckens, der Siedlungsdynamik , der Nutzung und Verteilung der natürlichen Ressourcen, der ökonomischen Grundlagen, der Bewirtschaftung, der räumlichen Erschließung über Nah- und Fern-Verbindungswege und Wasserwege, der territorialen Abgrenzung, der sozialen und politischen Organisation, der ethnischen Zusammensetzung der Bevölkerung, der Lage und Beziehung der heiligen Orte zu Siedlungsräumen . Pompeji mit seinem immensen Informationsgehalt an Daten und Fakten der historischen Perioden und die neu ausgegrabene bronze- bis eisenzeitliche Fluss-Niederlassung Longola-Poggiomarino bilden zwar selbstverständlich Schwerpunkte im Rahmen der Untersuchung, doch werden genauso alle übrigen Siedlungsplätze und menschlichen Niederlassungen im Sarno-Becken berücksichtigt.
Diese komplexen fach- und epochenübergreifenden Fragen sind nur im Zusammenwirken verschiedener Disziplinen und unter Beteiligung von Wissenschaftlern archäologischer, historisch-philologischer und naturwissenschaftlicher Fachrichtungen zu bearbeiten. Die multidisziplinäre Vernetzung des Projekts ist immanent, da die Bearbeitung der geo- und naturwissenschaftlichen Faktoren der naturräumlichen Veränderungen vielfach erst die Voraussetzung für die Auswertung der archäologisch-historischen Fragen bildet. Aufgrund der ständigen Überformung der Landschaft stellen sich hier zudem besondere technisch-methodische Herausforderungen an die geoarchäologischen Untersuchungen. In der Regel liegen die antiken Kulturhorizonte unter meterhohen Tephra-Auflagerungen und Sedimenten verborgen und verlangen den Einsatz spezieller naturwissenschaftlicher Prospektions- und Analyseverfahren, um "sichtbar" gemacht zu werden. Der Entwicklung und Anwendung geeigneter technischer Untersuchungsmethoden gilt daher ein besonderes Interesse innerhalb des Projekts.
Das Forschungsprojekt, das formell aus Kooperationen mit verschiedenen Institutionen und Wissenschaftlern in Deutschland und Italien besteht, hat das Ziel, die komplexen naturräumlichen und anthropogenen Veränderungsprozesse der Kulturlandschaften in der Sarno-Ebene auf der Grundlage geoarchäologischer Methoden zu untersuchen, die genetischen Vorgänge nach Epochen und Räumen zu beschreiben und die Ergebnisse in digitalen Rekonstruktionen von interpretierten Landschaftsmodellen darzustellen. Im Rahmen des Clusters "Politische Räume" ergeben sich vielfältige Schnittstellen mit verwandten Projekten, zunächst wird jedoch von einer Mitarbeit im Forschungsfeld "Erschließung und Nutzung" ein wissenschaftlicher Mehrwert erwartet.
Aktuelle Arbeiten:
Das Projekt nahm im Herbst 2006 seine Arbeit auf. In der ersten Phase wurden auf verschiedenen Ebenen Grundlagenarbeiten für das im Aufbau begriffene Geoinformationssystem unternommen. Parallel dazu wurde mit der Bearbeitung ausgewählter Forschungsthemen begonnen, unter anderem Projekte zur Analyse von Paläo-Böden in Verbindung mit der landwirtschaftlichen Nutzung der Villae rusticae, zur Rekonstruktion der Paläo-Oberfläche des Horizontes 79 n. Chr., zu Fragen des Vorkommens, Transports und der Verwendung von Baustoffen sowie zur Erschließung des Territoriums und zum Wegesystem. Die geoarchäologische Feldarbeit begann 2007 mit einer Serie von 15 Kernbohrungen im näheren Umkreis von Pompeji. Die seit 2004 laufenden dendrochronologischen Analysen der Holzbefunde in der Ausgrabung von Longola-Poggiomarino durch das naturwissenschaftliche Labor an der Zentrale des DAI tragen unter anderem auch zur Kenntnis des regionalen Waldökosystems bei und sollen Anhaltspunkte für Grobklimadaten liefern.
Kooperationspartner:
Soprintendenza Archeologica di Pompei
Soprintendenza per i Beni Archeologici delle Province di Salerno, Avellino e Benevento
Autorità di Bacino del Sarno
Commissariato di Governo per l'emergenza idrogeologica in Campania
Universität Potsdam, Institut für Geoökologie und Lehrstuhl für Landschaftsökologie und Bodenkunde
Heinrich-Heine Universität Düsseldorf, Mathematisch-Naturwissenschatliche Fakultät, Geographisches Institut
Dendrochronologisches Labor, Referat Naturwissenschaften, Deutsches Archäologisches Institut
Università degli Studi di Napoli Federico II, Polo delle Scienze e delle Tecnologie, Dipartimento di Scienze della Terra
Oxford University, Museum of Natural History
Wissenschaftlicher Beirat:
Dr. Giuliana Tocco, ehem. Soprintendente, Soprintendenza per i Beni Archeologici delle Province di Salerno, Avellino e Benevento
Prof. Pietro Giovanni Guzzo, Soprintendente, Soprintendenza Archeologica Pompei
Prof. Pietro Giuliano Cannata, Segretario Generale, Autorità di Bacino del Sarno
Prof. Dr. Dr. h.c. mult. Hermann Parzinger, Präsident des Deutschen Archäologischen Instituts
Dr. Werner Stackebrandt, Leiter der Abteilung Geologie, Landesamt für Bergbau, Geologie und Rohstoffe Brandenburg
Geoarchäologischer Berater:
Dott. Giovanni Di Maio
Bibliographie:
P. G. Guzzo, Pompei. Storia e paesaggi della città antica (Milano 2007).
F. Senatore, Stabiae. Dalla preistoria alla guerra greco-gotica (Pompei 2003).
A. Pecoraro (a cura di), Nuceria Alfaterna e il suo territorio (Nocera Inferiore 1994).
F. Seiler - P. Kastenmeier, La ricostruzione dei paleo-paesaggi nella piana del Sarno, in Quaderni Autorità di Bacino del Sarno. Studi, documentazione e ricerca, 1, 2007, 24-26.
F. Seiler, Projekt Sarno-Becken, Jahresbericht des Deutschen Archäologischen Instituts 2006 (Berlin 2007) 12-14.
F. Seiler, Rekonstruktion der antiken Kulturlandschaften des Sarno-Beckens. Ein multidisziplinäres Kooperationsprojekt mit Partnern aus Naturwissenschaften und Altertumswissenschaften in Deutschland, Italien und England, in: P. G. Guzzo - M. P. Guidobaldi (a cura di), Nuove ricerche archeologiche nell'area vesuviana (scavi 2003-2006). Convegno Internazionale, Roma 1-3 febbraio 2007 (Roma 2008) 485-490.