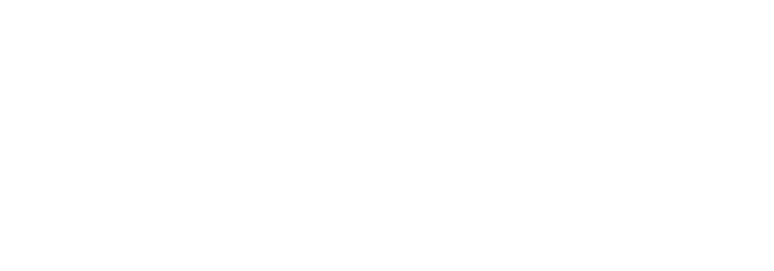Forschung
Forschungsziele
Die Untersuchung der Särge von el-Hibe im Ägyptischen Museum Kairo soll einen Beitrag zur Sargforschung liefern, indem sie eine repräsentative Gruppe eines bislang wenig erforschten Corpus von mittelägyptischen Särgen untersucht. Dabei sollen u. a. Fragen nach der Herstellung von Särgen allgemein, z. B. im Hinblick auf das Material, die Konstruktion etc., mit naturwissenschaftlichen Analyseverfahren beantwortet werden. Im Vergleich mit Särgen aus Mittelägypten und der Memphitischen Nekropole sollen überregionale Dynamiken in der Produktion dieser elementaren Objekte der Grabausstattung herausgestellt werden. Die Forschungen können dabei auch Hinweise für die Rekonstruktion der funerären und religiösen Praktiken in der Spätzeit geben.
Diese Forschungsfragen bewegen sich innerhalb des DAIK-Forschungsplan-Themenkomplexes „Kommunikation im sakralen Raum“, indem der Sarg als wichtiges Medium für funeräre Texte und Bilder, die die Wiedergeburt und den Schutz des Verstorbenen gewährleisten sollten, analysiert wird. Der Sarg ist somit selbst ein transformativer sakraler Raum. Belege für rituelle Handlungen am Sarg (z. B. Harzrückstände) können auf funeräre Rituale hindeuten und belegen somit die Kommunikationsprozesse der (lebenden) Gesellschaft innerhalb des sakralen Raums des Grabes/der Nekropole.
Übergeordnete Forschungsziele
Das Projekt wird in Kooperation mit den Kurator*innen und Restaurierungswissenschaftler*innen des Ägyptischen Museums Kairo sowie der Ain Shams Universität realisiert. Aus der Kooperation entstanden bereits zahlreiche Workshops und Trainings, nicht nur für die Mitarbeiter*innen des Museums sowie des Ministeriums für Tourismus und Antiken (MoT&A).
Die Forschungsergebnisse der Untersuchung der Särge sollen in die zukünftige Neukonzeption des Ägyptischen Museums, insbesondere der Galerien mit Särgen aus allen Epochen, einfließen. Durch konservatorisch adäquate Ausstellung der Objekte auf speziell angefertigten Holzbetten, neue Beschriftungen in der Vitrine sowie Infotafeln zum Projekt sollen die nun erstmals sichtbar gemachten Särge den Besucher*innen des Museums neu präsentiert werden.
Ansätze und Methoden
Durch ein Survey wurden zunächst die Risiken und Gefahren der Lagerungsbedingungen der Särge über den Zeitraum eines Jahres ermittelt. Dabei wurde tragbare Ausrüstung zur Messung der Temperatur, relativen Luftfeuchtigkeit, Lichtbelastung, Vibrationen durch Besucher*innen des Museums sowie Schadstoffen, Ungeziefer und mikrobiellen Befall etc. eingesetzt. Anschließend erfolgten dringend notwendige konservatorisch-restauratorische Maßnahmen an den Särgen, die v. a. die Schädlingsbekämpfung durch Begasungszelte, die Konsolidierung sowie die Reinigung beinhalteten.
Darüber hinaus wird eine vollständige Dokumentation der Särge angestrebt. Der Erhaltungszustand der neun Spätzeit-Särge vor und nach der Restaurierung wird durch digitale Fotografie, Fotogrammetrie und multi-spektrale Aufnahmen erfasst und kartiert. Die Rekonstruktion der Objektbiografien hilft, die wechselhafte Geschichte und die dadurch entstandenen Verschlechterungen des Erhaltungszustands zu verstehen. Außerdem werden sichere Maßnahmen für die künftige Aufbewahrung, Handhabung/Transport und Ausstellung der Särge vorschlagen.
Naturwissenschaftliche Untersuchungen der Särge mit XRF (Röntgenfluoreszenzspektrometer), multi-spektralen Bildgebungsverfahren (Infrarot/UV-Licht) und Mikroskopie gewähren einen Einblick in die unterschiedliche Herstellungsweise der Särge. Dabei können auch die Materialien, wie etwa die verwendeten Pigmente, identifiziert werden. Eine Analyse der Ikonografie und Texte der Särge im Vergleich mit dem Bild- und Textrepertoire weiterer spätzeitlicher Särge der Region und darüber hinaus vermag es, seltene Bildszenen wie etwa die außergewöhnliche Darstellung des Mumifizierungsprozesses, einzuordnen.