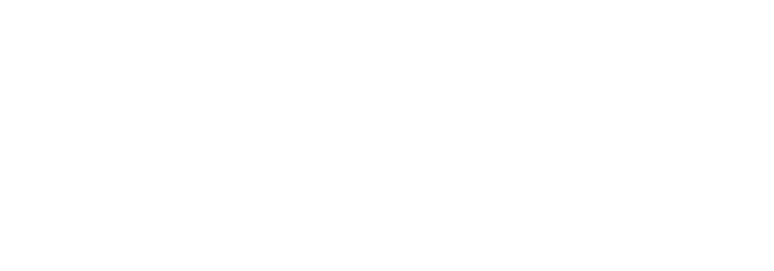Ergebnisse
Antike Reste finden sich im südlichen, dem einzigen windgeschützten teil der Insel: hier wurden die Reste eines phönizischen Heiligtums dokumentiert, das um die Mitte des 7. Jhs. v. Chr. entstand, und eine römische Villa aus der Zeit von Juba II mit Garumbecken. Das phönizische Areal, welches das Zentrum der Untersuchung darstellt, umfasst knappe 200 m². Seine ursprüngliche Ausdehnung kann nicht mehr festgestellt werden, denn Teile sind der Erosion des Atlantiks zum Opfer gefallen.
Ein 1,43 m hoher Baitylos, der auf dem Rand einer phönizischen Lampe eingeritzte Namen der Göttin Astarte, zahlreiche Lampen, Thymiateria, Ölfläschchen und Reibschalen sowie das Fehlen von Architektur lassen erahnen, dass es sich um ein hypäthrales Heiligtum handelt. Auf einstige Banketts verweisen tausende Scherben von phönizischem Tafelgeschirr und Amphoren. Die Gefäße, die nach ihrer Nutzung zerschlagen wurden, stammen aus unterschiedlichen phönizischen Hafenorten im Süden der Iberischen Halbinsel. Neutronenaktivierungsanalysen konnten mindestens fünf unterschiedliche Produktionsstätte identifizieren. Auf 133 Scherben konnten phönizische Graffiti beobachtet werden, bei den es sich vorrangig um Eigennamen handelt – die der Akteure der kultischen Banketts? Es ist sehr bemerkenswert, dass auf Mogador mehr Graffiti gefunden wurden als in allen anderen westphönizischen Niederlassungen.
Außer den Gefäßfragmenten befinden sich massenhaft Tierknochen in den kompakten Schichten im Umfeld des Baitylos. Sie belegen Spezialisierung von Meeresfischerei und Viehzucht, außerdem verweisen sie auf die kontinentale und maritime Ausdehnung des ‚Territoriums von Mogador‘. Besondere exotische Konnotationen bringen u.a. Knochen von Steppenelefanten und fünf jungen Löwen, unter denen sich der Mittelfußknochen mit einer Pathologie befindet, die zeigt, das der junge Löwe in Gefangenschaft gelebt hat. Waren diese exotischen Tiere Handelsware oder gehören sie zur Ausstattung des Astarte-heiligtums? Bemerkenswert ist jedenfalls, dass im Orient die aufwändige und gefährliche Jagd auf Elefanten und Löwen dem König vorbehalten war und dass das wertvolle Elfenbein im Umfeld der Paläste bearbeitet wurde. Unweit des Baitylos fanden sich die Spuren von spezialisierten Handwerkern, die ‚in phönizischer Weise‘ Bronze, Eisen (erstmals in der Region!) und Silber, Kochen, Horn und Elfenbein verarbeiteten. Woher die Handwerker stammten, wer ihre Auftraggeber und Kunden waren, konnte noch nicht bestimmt werden. Der Einzugsbereich von Waren (und Menschen?) war an diesem exotischen Platz jedenfalls deutlich größer als z.B. in den phönizischen Niederlassungen in Südspanien.
Auf der Insel fanden sich keine vorrömischen Architekturreste auch keine Süßwasserquelle. Die geographischen Untersuchungen erbrachten eine Erklärung für diese scheinbar paradoxe Situation: Mogador war bis zur Zeitenwende durch einen breiten Isthmus mit dem Festland verbunden.
Weder an der Küste noch im Hinterland von Mogador fanden sich trotz intensiver Suche und dem Einsatz geophysikalischer Prospektionsmethoden Spuren einer phönizischen oder phönizisch-zeitlichen einheimischen Siedlung. Vielleicht liegt der Grund zum einen in der landschaftlichen Konfiguration mit hohen wandernden Dünen an der Küste, der Verlagerung der Mündung des Oued Ksob und Erosion im Landesinneren und zum anderen in der eventuell nomadischen Siedlungsweise der einheimischen Bevölkerung. Für das Verständnis der phönizischen Niederlassung an dem entfernten Platz, sein politischer, gesellschaftlicher und wirtschaftlicher Zusammenhang mit der westphönizischen Kolonisation und den vorangegangenen risikoreichen Erkundungsfahrten entlang der dünn besiedelten Atlantikküste Marokkos bedarf der weiteren Untersuchungen, die im Gange sind.