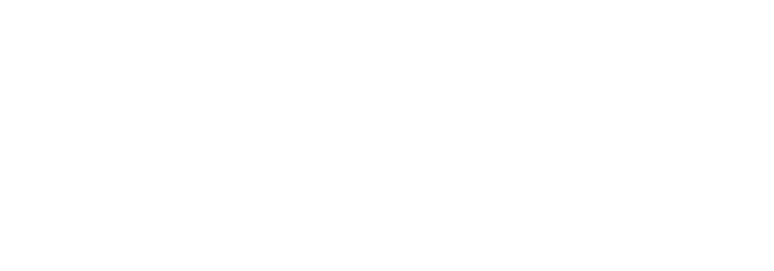Forschung
Mogador zog schon früh das Forschungsinteresse auf sich. 1902 schlug der Geograph P. Vidal de la Blache eine Identifizierung von Mogador mit den von Plinius nat. V, 5; VI, 199-201. 205 überlieferten Purpurinseln. P. Pallary gab 1908 mittelpaläolithische Silexartefakte bekannt, die er 1907 bei einer Begehung gesammelt hatte. 1950 führten J. Desacques und P. Koerberlé, beide Lehrer in Essaouira, Prospektionen durch. Sie machten die ersten phönizischen Funde: Amphorenfragmente mit phönizischen Graffiti und Tafelgeschirr der Roten Ware. P. Cintas führte 1952 die ersten Grabungen durch und datierte den Fundplatz in das 7. und 6. Jh. v. Chr. Unter der Leitung von A. Jodin wurden von 1956 bis 1858 die ersten systematischen Grabungen durchgeführt, die sich auf einen ‚Hügel‘ am Rande der Bucht an der Südseite der Insel konzentrierten und stratifizierte phönizische sowie punische und römische Funde und Befunde ergaben, hervorzuheben u.a. ein 1,43 m hoher Baitylos. Die zeitnahe Publikation einer Monographie war beispielhaft. 1958 folgten Grabungen M. Chevallier und M. Ponsich. Sie betrafen eine spätrömische Nekropole. F. Villard legte 1960 die griechischen Keramikfunde vor. 2000 Fand i Rahmen eines marokkanisch-spanischen Projektes unter der Leitung von A. ElKhayari und F. López Pardo eine Prospektion statt.
Das deutschmarokkanische Projekt wurde am 19. Juli 2005 mit einem Vertrag zwischen dem Institut des Sciences de l’Archéologie et du Patrimoine (INSAP), Rabat und dem Deutschen Archäologischen Institut begonnen. Von Seiten des DAI sind die Abteilung Madrid und die Bonner Kommission für Archäologie Auereuropäischer Kulturen gleichermaßen beteiligt. Die diachrone Untersuchung der Landschafts- und Besiedlungsgeschichte bildet den Rahmen des multi- bzw. interdisziplinär konzipierten Projektes. Es betrachtet die Insel als Teil des Umlandes und umfasst ein weites Territorium, das sich auf Mogador, die umliegenden Inseln, die Meeresbucht von Essaouira und die Küstenregion von Gebel Hadid im Norden bis Ounara im Osten und Oued Tidzi im Süden erstreckt. Bei der diachronen Forschung wird versucht, die Gesamtentwicklung zu berücksichtigen, wobei die ‚Zeit der Phönizier‘ im Mittelpunkt des Interesses steht.
An den Forschungen haben sich außer Archäologen Geographen, Geophysiker, Topographen, Zoologen, Archäometallurgen, Chemiker, Restauratoren und Unterwasserarchäologen beteiligt.