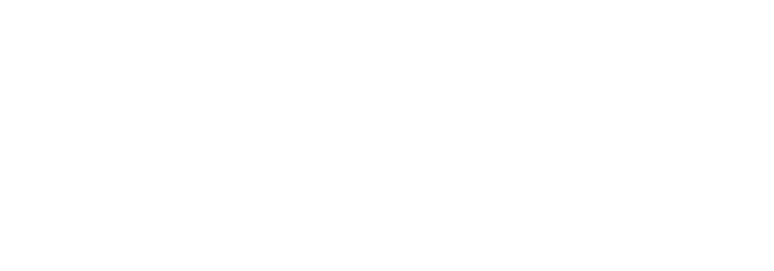Forschung
In der Zeit um 1200 v. Chr. gingen alle mykenischen Palastzentren in Feuersbrünsten unter, deren Ursachen kontrovers diskutiert und von einigen in Erdbeben, von anderen in Kriegshandlungen gesucht werden. Bis in die 1960er Jahre hinein ging die Forschung davon aus, dass als Folge dieses umfassenden Zerstörungshorizontes die vormaligen Palastzenten stark schrumpften, wenn nicht sogar teilweise verlassen wurden, und, wie die mykenische Kultur im Allgemeinen, in “Dunklen Jahrhunderten” versanken. Seitdem erzielte Forschungsergebnisse haben indes zu der Erkenntnis geführt, dass ein pauschales Urteil über den letzten, nachpalastzeitlichen Abschnitt der mykenischen Kultur zwischen ca. 1200-1050 v. Chr. nicht möglich ist, da es gravierende regionale Unterschiede in den Auswirkungen des Einschnitts um 1200 v. Chr. gegeben hat. Nirgends wird dies deutlicher als in Tiryns, das anders als alle anderen vormaligen Palastzentren schon bald nach der Palastzerstörung wieder Belege einer politischen Konsolidierung erkennen lässt, im Rahmen derer neue Bauprojekte verwirklicht wurden. Überraschenderweise scheint es hierdurch sogar zu einer Ausdehnung der besiedelten Fläche gekommen zu sein.
Es gibt, abgesehen von dem Palastareal auf der Oberburg, keinen anderen Siedlungsteil, in dem sich diese außergewöhnliche Dynamik derart klar manifestiert wie in der nördlichen Unterstadt. Dort hatte im Laufe des 13. Jhs. v. Chr. ein aus dem Hinterland kommender Fluss mehrfach für Überschwemmungen gesorgt, so dass sich die palatialen Machthaber dazu entschlossen, diesen mit Hilfe eines am seinem Oberlauf angelegten Dammes durch ein neues Flussbett umzuleiten. Neben der Bannung der von dem Fluss ausgehenden Überschwemmungsgefahr wird die Gewinnung neuen Baulandes nördlich der Akropolis einer der Faktoren gewesen sein, die den Ausschlag zur Durchführung dieser gewaltigen Baumaßnahme gegeben hat. Nach den bisher verfügbaren Indizien scheint aber erst nach Zerstörung des Palastes ab dem frühen 12. Jh. v. Chr. auf den trocken gefallenen Flusssedimenten, ein neuer Siedlungsteil geschaffen worden zu sein. Dass man in jener Zeit so nahtlos an palastzeitliche Bauplanungen anschließen konnte, spricht dafür, dass die für die neuen Bauvorhaben Verantwortlichen sich aus dem Kreis der Würdenträger der ausgehenden Palastzeit rekrutierten. Eine von der Deutschen Forschungsgemeinschaft geförderte, in Zusammenarbeit zwischen Alkestis Papadimitriou (griechischer Antikendienst, Ephorie Nauplio), Joseph Maran (Universität Heidelberg) und dem DAI durchgeführte Ausgrabung erforscht seit 2013 in der nordwestlichen Unterstadt von Tiryns die sich in diesem Teil des Ortes entfaltende neue Dynamik von Siedlungsplanungen des 12. Jahrhunderts v. Chr. Da die gesamte Zone vorher unbebaut war, bot sich für die Menschen der Jahrzehnte nach 1200 v. Chr. die seltene Gelegenheit, die Neubebauung zu planen, ohne auf ältere Gebäude Rücksicht nehmen zu müssen. Aus der Analyse der Architektur und ihrer Einrichtung lassen sich somit Einblicke in jene kulturelle Normen und Praktiken gewinnen, auf der Grundlage derer die Bewohner ihre Lebenswelt gestalteten.
Die international und interdisziplinär ausgerichtete Ausgrabung findet in Zusammenarbeit mit Forschern aus Griechenland, Israel, den USA, Kanada, den Niederlanden und Deutschland statt. Es wird eine Vielzahl neuer mikroarchäologischer Verfahren eingesetzt, die Aufschlüsse darüber geben können, wie z.B. Räume und darin befindliche Installationen genutzt, welche Tiere und Pflanzen gegessen, wie Objekte verwendet, was in Gefäßen enthalten oder auf Mahlsteinen gerieben wurde.
Forschungsziel ist es, die sich im Anschluss an die Zerstörung des Palastes, während der Phase SH IIIC, d.h. dem 12. Jh. und frühen 11. Jh. v. Chr. in diesem Teil des Ortes entfaltende Dynamik von Siedlungsplanungen besser zu verstehen. Die im Grabungsareal vorliegenden Siedlungsreste sollen dabei als Archiv zur Analyse der Kultur- und Sozialgeschichte desjenigen Zeitabschnitts erschlossen werden, während dem die Geschichte der mykenischen Gemeinschaft von Tiryns einen von allen anderen mykenischen Zentren so auffällig abweichenden Verlauf nahm.
Seit Sommer 2013 finden in der nordwestlichen Unterstadt unter Leitung von Prof. Joseph Maran (Institut für Ur- und Frühgeschichte, Heidelberg) und Alkestis Papadimitriou (griechischer Antikendienst, Ephorie Nauplio) Ausgrabungen statt, die von der Deutschen Forschungsgemeinschaft gefördert werden.