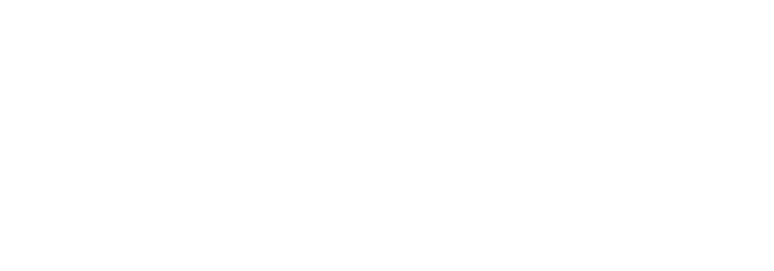Ergebnisse
Ergebnisse
1. Bau- und Nutzungsgeschichte der Basilica Iulia
Bei unseren Untersuchungen konnten acht Bauphasen im Bereich der Basilica Iulia festgestellt werden. Die ältesten nachweisbaren Schichten in diesem Areal stammen aus der Zeit um 500 v. Chr. Vermutlich fungierte die älteste und tiefste Struktur als Kanalsohle. Die feuchte Parzelle musste vor umfangreicheren Bauarbeiten trockengelegt werden. Wahrscheinlich existierte im 4. Jh. v. Chr. in der Südhälfte der Parzelle ein Gebäude mit einem Innenhof, dessen Pflasterung und Umgang in spärlichen Resten belegt sind. Spätestens zu Beginn des 3. Jhs. v. Chr. erbaute man parallel zur Via Sacra eine Reihe von Läden, die Tabernen veteres, die nach einem Brand im Jahr 209 v. Chr. erneuert wurden. Die Fundamente der 170 v. Chr. errichteten Basilica Sempronia erhoben sich über einem umfangreichen Drainagesystem. Sie entsprechen mit ihren Tuffblöcken und Steinmetzzeichen den Fundamenten der Basilica Fulvia des M. Aemilius Lepidus von 179 v. Chr. Wie diese so wurde auch die Basilica Sempronia an die älteren Tabernen angebaut. Der monumentale Neubau entsprach in den Dimensionen der Fläche weitgehend den beiden Nachfolgerbauten aus caesarischer und augusteischer Zeit. In der 2. Hälfte des 2. Jhs. v. Chr. versah man die Basilica mit umlaufenden Halbsäulenfassaden. Eine umfangreiche Baumaßnahme fand in der 1. Hälfte des 1. Jh. v. Chr. statt, indem die Tabernen an den Südrand der Parzelle verlegt und mit einer Portikus ausgestattet wurden. Die Basilika hatte jetzt ein Mittelschiff mit zwei umlaufenden Ringhallen, wobei das Bauwerk dieses Schema bis zu seiner Aufgabe unverändert beibehielt (Abb. 1).
In caesarischer Zeit erhielt die Basilica Iulia eine marmorne Verkleidung. Dazu gehören die großen Marmorplatten des Fußbodens und die marmornen Halbsäulen der Nordfassade. Vermutlich kamen aber die Arbeiten am Fußboden des Mittelschiffs mit den drei Quadraten aus buntem Marmor erst während der Herrschaft des Kaisers Augustus zum Abschluss (Abb. 1). Die Basilica Iulia entspricht in dem Dekorationsschema des marmornen Fußbodens der Basilica Aemilia, wobei letztere aber eine differenziertere Arbeit aufweist (Abb. 2). Aus dieser Epoche oder gar früher stammen auch die Wände und Pfeiler aus Travertin, die nach einem Brand des Gebäudes im Jahr 283 n. mit Ziegelmauerwerk ausgebessert oder neu hergestellt wurden. Die Ausstattung mit Pfeilern geschah nicht erst im 3. Jh. n. Chr. und ist auch nicht das Produkt einer neuzeitlichen Ergänzung, wie mehrfach vermutet wurde, sondern sie war Bestandteil des spätrepublikanischen Bauwerks (Abb. 3). Ein gutes Vergleichsbeispiel bietet die Pfeilerbasilika in der caesarischen Kolonie Carsulae bei Todi in Umbrien, die wahrscheinlich um die Mitte des 1. Jhs. v. Chr. errichtet wurde. Von diesen Gebäuden unterscheidet sich entschieden der spätantike Pfeilerbau der Maxentius-Basilica in Rom, der im Grund- und Aufriss mit den Thermen des Diokletian vergleichbar ist.
Zu der Restaurierungsphase im späten 3. Jh. n. Chr. gehören auch die Pfeilerportiken mit den Bögen aus Ziegeln, deren originaler Bestand nur noch in der Südwestecke des Bauwerks erhalten ist, während alle übrigen Partien im 19. Jahrhundert weitgehend ergänzt wurden.
In spätantiker Zeit behielt die Basilica Iulia ungebrochen ihre Bedeutung und hohen Stellenwert bei. Selbst der Brand um 410 n. Chr., bei dem mehrere Gebäude im westlichen Bereich des Forum Romanum beschädigt wurden, hatte keine Aufgabe oder eine reduzierte Nutzung der Bauwerke zur Folge. Wie ihr nördliches Pendant so behielt auch die Basilica Iulia weiterhin ihre Bestimmung als Börse und Gerichtsgebäude bei. Erst der Einbau der Kirche S. Maria in Cannapara an der Südwestecke im äußersten Südschiff im 7. oder 8. Jh. und die in diesem Bereich installierten Kalköfen mit Werkstätten und Läden markieren die Aufgabe der Basilica Iulia und wohl auch der Basilica Aemilia in deren bisherigen Bestimmung.
2. Ergebnisse in Relation zum bisherigen Forschungsstand:
Zum ersten Mal konnten acht Bauphasen im Bereich der Basilica Iulia nachgewiesen werden. Diese Chronologie ist entschieden differenzierter als die bisherige Datierung, die vor allem auf den Untersuchungen von Carettoni – Fabbrini 1961, 53ff. basiert. Ein wesentliches Ergebnis ist der Nachweis, dass es sich bei dem Bauwerk der Basilica Iulia um eine Pfeilerbasilika mit Arkaden handelt (Abb. 3). Es ist nicht ausgeschlossen, dass diese Formgebung, die das Gebäude spätestens in caesarischer Zeit hatte, schon für die Basilica Sempronia bestand.
Der marmorne Fußboden im Mittelschiff der Basilica Iulia konnte vollständig rekonstruiert werden (Abb. 1). Im Unterschied zu dem Rekonstruktionsvorschlag von Appetecchia (A. Appetecchia, I pavimenti marmorei praticamente inediti della Basilica Iulia e della Basilica Aemilia al foro romano, in: C. Angelelli – A. Paribeni [Hrsg.], Atti del XII colloquio dell’associazione italiana per lo studio e la conservazione del mosaico, Padova, 14–15 e 17 febbraio – Brescia, 16 febbraio 2006 [Rom 2007] 221-223 Abb. 2.3) ließ sich auch die farbige Zusammensetzung aus bunten Marmorsorten detailgetreu bestimmen. Es fällt auf, dass sich die marmornen Fußböden der Basilica Aemilia und Basilica Iulia im kompositorischen Aufbau weitgehend gleichen, sich aber in der farbigen Zusammensetzung voneinander unterscheiden (Abb. 1.2). Beide Böden wurden nach ein und demselben Grundmuster in caesarischer Zeit konzipiert, aber erst in augusteischer Zeit vollendet.
3. Lage und Rekonstruktion des ‚Tiberiusbogens‛
In augusteischer Zeit wurde ein Torbogen an der Nordwestecke der Basilica Iulia nahe am Lacus Servilius errichtet. Dieser als ‚Tiberiusbogen‛ bezeichnete Torbau lag nicht zwischen den Rostra und der Basilica Iulia, wie allgemein angenommen wird (E. Nash, Bildlexikon zur Topographie des antiken Rom Band II [Tübingen 1961] 131f. Abb. 140 ; ders. Band II [Tübingen 1962] 18 Abb. 689), sondern er überspannte mit einem Durchgang den Südarm der Via Sacra und stand dem neben dem Tempel des Divus Iulius aufragenden Augustusbogen gegenüber. Von dem Bogen sind mehrere Gebälke und Fragmente des aufgehenden Mauerwerks erhalten, aus deren Aufnahme und Auswertung sich zwei Rekonstruktionsmöglichkeiten ergaben. Beide Versionen zeigen einen mit einem Tonnengewölbe überspannten Durchgang, wobei die erste mit einem Blendgiebel vor einer hohen Attika, die zweite mit einem horizontalen Gebälk und darüber aufragender Attika versehen ist. Der ‚Tiberiusbogen‛, der in augusteischer Zeit errichtet und von Tiberius eingeweiht wurde, stand auf gleicher Höhe wie der nördlich stehende Bogen des Septimius Severus. Allem Anschein nach hatte dieser Torbau einen Vorgängerbau aus augusteischer Zeit, der wohl mit dem ‚Partherbogen‛ zu identifizieren ist (K. S. Freyberger, Das Forum Romanum: Spiegel der Stadtgeschichte des antiken Rom2 [Mainz 2012] 68-70; K. S. Freyberger – C. Ertel – K. Tacke, Die Basilica Aemilia auf dem Forum Romanum in Rom: Ein öffentlicher Luxusbau für Handel und Justiz [erscheint in den Sonderschriften des DAI-Rom 2014]. Erweist sich die Annahme als korrekt, dann wäre das zentrale Forumsareal über vier Torbauten zugänglich gewesen, wobei sich jeweils zwei Torbauten am Nod- und Südarm der Via Sacra gegenüberstanden. Vermutlich befanden sich an diesen Stellen oder zumindest in der Nähe der jetzigen Bögen in spätrepublikanischer Zeit Vorgängerbauten. Ein signifikantes Beispiel dafür bietet der Fornix Fabianus, der auf der Höhe der Westante des Tempels des Iuppiter Stator, des heutigen Tempels des Antoninus Pius und der Faustina, aufragte (K. S. Freyberger, Das Forum Romanum: Spiegel der Stadtgeschichte des antiken Rom2 [Mainz 2012] 124f.; ders., Zur Herausbildung sakraler Kommunikationsräume im Zentrum des antiken Rom, in: R. Kussl [Hrsg.], Altsprachlicher Unterricht Kompetenzen, Texte und Themen [Speyer 2012] 217-220; C. Ertel – K. S. Freyberger, Sakrale Räume im Zentrum von Rom in der späten Republik und der frühen Kaiserzeit, KölnJb 46, 2014 [im Druck]).
4. Funktion und Nutzung der Basiliken auf dem Forum Romanum
4.1. Die Großbasiliken als Zweckbauten für Handels- und Geldgeschäfte
Im 2. Jh. v. Chr. wurden große Basiliken auf dem Forum Romanum im Zuge des monumentalen Ausbaus öffentlicher Gebäude errichtet. Zu den ältesten bekannten Bauten gehörte die Basilica Porcia, die nach den Überlieferungen von Livius (39,44) und Plutarch (Plut. Cato maior 19) im frühen 2. Jh. v. Chr. errichtet wurde. Nach den Texten zu urteilen, betrieben die Bankiers (argentarii) und Geschäftsleute (negotiantes) in dem Bau ihre Großhandelsgeschäfte. Darüber hinaus fanden in der Basilika wahrscheinlich auch die Vergabe öffentlicher Aufträge und die Verpachtung der Einnahmen statt. Da die Basilica Porcia die umfangreichen Handels- und Geldgeschäfte auf dem Forum Romanum allein nicht bewältigen konnte, mussten weitere Bankgebäude wie die Basilica Fulvia und die Basilica Sempronia erbaut werden, um den fiskalischen Anforderungen Genüge zu leisten. Beide Großbauten dienten in der späten Republik und auch in der Kaiserzeit als Zentren für den Vollzug der Großhandels- und Geldgeschäfte. Es ist denkbar, dass führende Mitglieder der Sempronier und Aemilier als Großhändler Kapital und Kredite zur Verfügung stellten und dabei großen Zinsgewinn machten. Zur Durchführung und Kontrolle der Geldgeschäfte setzten sie vermutlich ihre Freigelassenen als Geschäftsführer ein wie es Cato mit seinem Freigelassenen Quintio tat (Plut. Cato maior 21).
Die tabernae argentariae waren nicht nur einfache „Geldwechslerbuden“, sondern Geschäftsräume der Bankiers. Diese Annahme wird vor allem durch die kostbare Ausstattung der Räume erhärtet, deren Böden mit opus sectile sowie deren Wände mit Stuck und später in der Kaiserzeit mit Marmorplatten verziert waren. In den Kontoren der Bankiers wurden die für den Bankverkehr unerlässlichen Dienstleistungen vollzogen, wozu die Ausstellungen von Quittungen, Schuldscheinen, Verträgen und andere für das Finanzwesen wichtige Vereinbarungen gehörten. Schon in der späten Republik präsentierten sich die großen Basiliken auf dem Forum Romanum als luxuriöse Bankbauten und Börsen, deren Pracht in der Kaiserzeit die marmornen Wandinkrustationen, die Böden aus buntem Marmor, der aufwendig gestaltete Baudekor und die Bildwerke aus Stuck und Marmor noch steigerten.
Wenn auch mit Veränderungen so behielten die Basilica Iulia und auch die Basilica Aemilia ihre Funktion als Bank und Börse bis in die hohe Kaiserzeit und die Spätantike weitgehend bei. Die in kaiserzeitlichen Inschriften als nummularii bezeichneten Geldwechsler in der Basilica Iula hatten ihren Standort nicht in den tabernae veteres wie die Bankiers in der Zeit der späten Republik, sondern in einem der Seitenschiffe oder in den Portiken der zum Forumsplatz ausgerichteten Nordfassade. In diesem Bereich befinden sich breite streifenförmige Vertiefungen, in denen wahrscheinlich die Wände von Läden eingelassen waren.
4.2. Die Basiliken auf dem Forum Romanum als Gerichtsgebäude
Die Basiliken auf dem Forum Romanum fungierten nicht nur als Banken und Börsen, sondern auch als Gerichtsstätten. In diesen fanden Zivilprozesse, die vor allem der Verpachtung von Steuereinnahmen, der Verwaltung von Gütern und Erbschaftsangelegenheiten galten. Letztere Funktion hatten sie nicht erst in der Kaiserzeit, sondern wahrscheinlich von Anfang an. Das früheste bekannte schriftliche Zeugnis dafür liefert ein senatus consultum aus dem Jahr 112 v. Chr., der in der Basilica Porcia einen Streit zwischen den Hierapytniern und den Itaniern entschied. Da die Prozesse viel besucht waren, wurden große Räume benötigt. Im Erdgeschoss war nur bedingt Platz für die Zuschauer, zumal in diesem Bereich die Bankiers und Geschäftsleute tätig waren. Platz für die Besucher bot vor allem das Obergeschoss mit seinen Emporen, von dem aus die Prozesse verfolgt werden konnten. Laut den Angaben von Vitruv (5,1,5) waren die Emporen als Aufenthaltsort für Besucher und Flaneure bestimmt. Diese sollten aber den Forderungen Vitruvs zufolge keinen direkten Einblick in die Geschäftsvorgänge im darunterliegenden Geschoss haben. Eine entsprechend hohe Brüstung im Obergeschoss gab den Blick wohl hauptsächlich nur auf das Mittelschiff frei. Diese Punkte legen nahe, dass die Geschäftsvorgänge wie das Verleihen von Kapital, die Bürgschaften und die Vertragsabschlüsse wahrscheinlich eher in den von oben nicht leicht einsehbaren Seitenschiffen oder gar in den geschlossenen Tabernen auf der Südseite stattfanden. Damit die Besucher im Obergeschoss die Gerichtsverhandlungen aber verfolgen konnten, mussten diese im Mittelschiff der Aula stattgefunden haben.
Schon in der Republik wurden Gerichtsverhandlungen in Räumen und damit verbunden auch in den Basiliken auf dem Forum Romanum abgehalten, zumal in den kalten und regnerischen Wintermonaten die Durchführung von Prozessen im Freien kaum möglich war. Aufgrund der ständig wachsenden Bevölkerung nahmen in der Kaiserzeit das Prozesswesen und die Zahl der Besucher in den Gerichtsstätten von Rom derart zu, dass nicht nur auf dem Forum Romanum, sondern auch auf dem Caesar-Forum und Augustusforum Gerichtsverhandlungen stattfanden und dabei auch die Errichtung weiterer Basiliken notwendig war.
5. Genese der Basilika
Die Genese der Basilica ist ein vieldiskutiertes Thema, das in der Forschung kontrovers beurteilt wird. Die Basilica Fulvia ist das älteste bekannte nachweisbare Bauwerk in Rom, das dem Schema einer mehrschiffigen Halle mit vorgestellten Läden und einer Portikus folgt. Zu fragen bleibt, ob es an der Stelle dieses Gebäudes einen oder gar mehrere Vorgängerbauten gab. Bei unseren jüngsten Untersuchungen im nördlichen Areal der Basilica Aemilia fanden sich Spuren eines Bauwerks, bei dem es sich mit großer Wahrscheinlichkeit nach um einen Vorgängerbau der Basilica Fulvia (Basilica I) handelt. Das Gebäude, das im Bereich unter dem Nord- und Mittelschiff der Basilica Aemilia liegt, besaß eine dreischiffige Halle mit zwei Säulenreihen, deren 8,50 m große Achsabstand kleiner ist als der 12 m weite in dem spätrepublikanischen Bau (Abb. 4). Liegt die Nordwand beider Bauwerke deckungsgleich auf einer Höhe, so reicht die Südwand der Basilica Fulvia und deren Nachfolger weiter nach Süden. Die Frage, um wie viel älter die Basilica I als ihr Nachfolger ist, lässt sich allein aus den archäologischen Fakten nicht beantworten. Plautus (Captivi 813-815; Curculio 470-482) nennt eine Basilika auf dem Forum Romanum, die älter war als die Basilica Fulvia. Es könnte sich bei diesem erwähnten Bauwerk tatsächlich um die Basilica I handeln, zumal die Ortsangabe in der Nähe des forum piscarium, also wahrscheinlich an der Stelle der späteren Basilica Fulvia, mit der Lage der jüngst entdeckten Basilica übereinstimmt. Livius (27, 11, 16) berichtet von einem Brand im Jahr 209 v. Chr., dem sieben Kaufläden, ein Kaufhaus, eine Halle und das Königshaus zum Opfer gefallen sind. Handelt es sich bei dem Königshaus unmissverständlich um das Atrium Regium, so kann aber nicht mit Sicherheit die Halle mit der Basilica I identifiziert werden. Entweder war letztere ein eigener Bau oder Bestandteil des Atrium Regium. Wie dem auch sei, auf jeden Fall existierte die Basilica I bereits vor der im Jahr 209 v. Chr. ausgebrochenen Feuersbrunst. Als weiteres chronologisches Indiz sind die von Cicero (ac. 2, 22, 70-71) überlieferten maeniana verwertbar, die als erhöhte Terrassen über den tabernae veteres und den tabernae novae entlang der Längsseiten des Forumsplatzes verliefen. Dabei gehörten letztere zur Basilica Aemilia, während erstere sich vor der gegenüberliegenden Basilica Iulia auf der südlichen Längsseite des zentralen Forumsareals befanden. Die maeniana und die tabernae argentariae waren demnach untrennbar miteinander verbunden, zumal die Läden mit den davor liegenden Portiken als Träger der erhöhten Terrassen fungierten. Nur deren vorderster Teil sprang über die Portiken vor und endete in einer Brüstung. Mit Sicherheit gab es die maeniana aber schon vor dem Bau der beiden Basiliken, zumal sie nach ihrem Schöpfer C. Maenius benannt sind. Dieser war 338 v. Chr. Konsul, 318 v. Chr. Censor. Da nach Festus C. Maenius während seiner Amtszeit als Censor erstmalig die maeniana auf dem Forum anbringen ließ, sind diese gegen Ende des 4. Jhs. v. Chr. zu datieren. Vor diesem Hintergrund ist nicht ausgeschlossen, dass bereits die Basilica I eine Terrasse dieser Art hatte. Dabei wurde das Bauwerk mit großer Wahrscheinlichkeit schon in dieser Zeit oder kurz danach am Beginn des 3. Jhs. v. Chr. im Zuge der Neugestaltung des Forums errichtet.
Die Untersuchungen erbrachten den archäologischen Nachweis für die schon mehrfach geäußerte Vermutung, dass ein Vorgängerbau im Bereich der 179 v. Chr. eingeweihten Basilica Fulvia existierte. Nach den Ergebnissen zu schließen, bildeten sich die späteren Leitformen der stadtrömischen Basilika (Säulenbau, Terrassen über Tabernen) schon in früher Zeit, spätestens im 3. Jh. v. Chr., heraus.