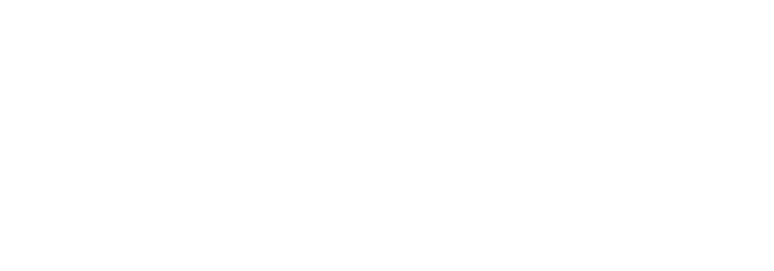Forschung
Fragestellung
Die verfügbaren Zeugnisse aller Quellengattungen (materielle, epigraphische, literarische Zeugnisse) müssen gleichwertig berücksichtigt werden. Die Betrachtung nur einer Quellengattung (z.B. archäologisches Material) allein ist irreführend und führt zu Verzerrungen. Die durch diese Zeugnisse belegten Kultplätze und Kultaktivitäten werden einer synoptischen Analyse unterzogen. Die Leitfragen betreffen drei Bereiche.
(1) Als erstes die Topologie: darunter fallen Aspekte wie die Disposition und Distribution der Kultplätze und Heiligtümer im Stadtgefüge sowie die Integration derselben im Stadtgefüge, die Verbindungen zwischen diesen und Bauten von anderer Funktion und die topographische und funktionale Relation zu denselben. Gibt es mögliche Verschiebungen in der Positionierung, etwa vom Zentrum zur Peripherie? Die jeweilige Umgebung eines Heiligtums kann ein determinierender Faktor für seinen Fortbestand oder sein Ende sein. Parallele oder antiparallele Entwicklungen in ein- und demselben Areal müssen aufgespürt werden, um die unterschiedliche Dynamik, die unterschiedlichen Geschwindigkeiten und Mechanismen der Veränderungen in jeweiligen Arealen und ihre Gründe aufzuzeigen. Die wechselnde Rechtslage schliesslich hat auch eine unmittelbare Auswirkung auf die Veränderungen in der Sakraltopographie. Und schliesslich muss festgestellt werden, ob es Wechselwirkungen und eventuelle Überlappungen mit der Kulttopographie der christlichen Religion gibt.
(2) Zweitens die Prosopographie, die soziale Dimension: Wer waren die die Akteure der paganen Kultausübung, die, zunächst auf einer offiziellen, dann auf einer privaten, und schliesslich auf klandestiner Ebene die traditionellen Kulte pflegten? Die Ämter in den offiziellen Priesterkollegien waren in der Kaiserzeit sehr prestigeträchtig und daher begehrt – wie und wann verlieren sie in der Spätantike ihre Attraktivität? Können wir in den verfügbaren Quellen die Bildung von Netzwerken, von Gruppen und Assoziationen feststellen und damit die Handlungen dieser Akteure auf einer kollektiven und einer individuellen Ebene aufzeigen? Was waren ihre Interessen und Motivationen? Diese können politischer, religiöser, kultureller Natur sein.
(3) Und schliesslich, drittens, die religiöse Dimension: die sacra publica und die sacra privata unterlagen sakralrechtlich unterschiedlichen Bedingungen und konnten daher unterschiedliche Möglichkeiten der Ausübung aufweisen. Es stellt sich die Frage nach eventuellen Möglichkeiten der „Privatisierung“ von bestimmten Elementen der sacra publica. Die bei den „traditionellen“ und den „orientalischen“ Kulten beobachtete jeweils unterschiedliche Dynamik der Veränderung, des Fortlebens bzw. des Endes – früher mit religiösen Inhalten erklärt – lässt sich auch auf die sakralrechtlich unterschiedliche Bedingung für sacra publica bzw. sacra privata zurückführen: die „orientalischen“ Kulte gehörten zumeist den sacra privata an und konnten daher mit unterschiedlichen Mitteln, auf privater Ebene und daher auch länger aufrechterhalten werden; anders die zu den sacra privata gehörigen offiziellen Kulte und Feste, die von offizieller Seite instandgehalten wurden. Die assoziierten Funktionen von Kultbauten und deren mögliche Auswirkungen auf einen längeren Fortbestand dieser Bauten gehört auch in diesen Komplex, insbesondere wegen der Untrennbarkeit der sakralen und der profanen Sphäre in der römischen Lebenswelt.
Forschungsziele
Die synoptische Untersuchung der Sakraltopographie des spätantiken Rom ist ein Forschungsdesiderat. Ziel dieser Untersuchung ist eine Monographie, in der nach den ausgeführten Leitfragen die Transformationen des spätantiken Rom beleuchtet werden. Die Relevanz der Untersuchung liegt darin, dass sie wesentliche neue Erkenntnisse zu unserem Bild von der Stadt Rom in ihrer topographischen, urbanistischen, sozialen und religiösen Dimension in einer Zeit der grundlegenden Transformationen bringen wird.
Ansätze und Methoden
Die für die Untersuchung angewandte Methode lässt sich mit dem Begriff „Synopse“ subsumieren. Dieser synoptische Blick auf ganz Stadtrom in seiner sakraltopographischen Dimension ist grundlegend neu und beinhaltet folgende vier Aspekte.
(1) Bei der synoptischen Untersuchung muss die Epoche der Spätantike intrinsisch betrachtet werden, als ein Kapitel der tausendjährigen Geschichte der „paganen“ Stadt Rom und in der Nutzung der stadtrömischen Sakrallandschaft.
(2) Die Dimension des Raumes: Die synoptische Untersuchung berücksichtigt sämtliche Kultplätze der Stadt und alle Areale. Rom wird in sakraltopographischer Hinsicht erstmalig zusammen mit seinem suburbium untersucht: der synoptische Ansatz erfordert, dass urbs und suburbium als Einheit verstanden und zusammen betrachtet werden als der zusammenhängende rituelle Aktionsraum, den sie tatsächlich gebildet haben
(3) Die Dimension der Zeit: in der Untersuchung müssen die Dimensionen des Raumes und der Zeit zusammengeführt werden. Die im Raum und in der Zeit zugleich verankerte Sakralität der Stadt Rom war als Gedanke schon von Livius (5,52,2) formuliert worden.
(4), als letzter Aspekt, der die bisher genannten in sich zusammenführt: Die Untersuchung der Verbindungen, sowohl hinsichtlich der gebauten Elemente in der räumlichen Dimension (wie etwa Strassen) als auch hinsichtlich der performativen Elemente in der zeitlichen Dimension (ephemere Verbindungen etwa in Form von Prozessionen, die zu bestimmten, im römischen Kalender festgelegten Festtagen stattfinden).
Forschungsgeschichte
Die bisherige Erforschung von Roms spätantiker Sakraltopographie hat sich in erster Linie auf den christlichen Kult gerichtet. Untersucht wurden die frühen Bauten des christlichen Kultes (Kirchen, Diakonien) und die zunehmende Okkupation des städtischen Raumes durch die sich immer mehr ausbreitende neue Religion, die von oberster Stelle gefördert wurde.
Dahinter, darunter, im Hintergrund, immer schon dagewesen, war aber immer noch die Topographie der alten, der traditionellen römischen Religion, die seit Jahrhunderten fester und selbstverständlicher Teil des Stadtgefüges, ja sogar von diesem untrennbar war.
Die synoptische Untersuchung der paganen Kulttopographie des spätantiken Rom ist ein Forschungsdesiderat. Diejenigen Studien, die sich mit den paganen Kulten des spätantiken Rom beschäftigen, beschränken sich entweder auf einzelne, limitierte Zonen der Stadt oder auf die Kultplätze von einzelnen Gottheiten. Dementsprechend besteht unser Bild von Roms Sakraltopographie aus punktuellen Einheiten. Hinzu kommen auch die problematische Grabungssituation in Rom und entsprechend die Publikationslage, die zu „weissen Stellen“ auf dem Stadtplan führen: manche Gebiete sind mehr, manche sind weniger gut ergraben und publiziert. Darüber hinaus liegt bislang keine Studie zur Sakraltopographie Roms in der Kaiserzeit vor, auf der diese Untersuchung aufbauen könnte.