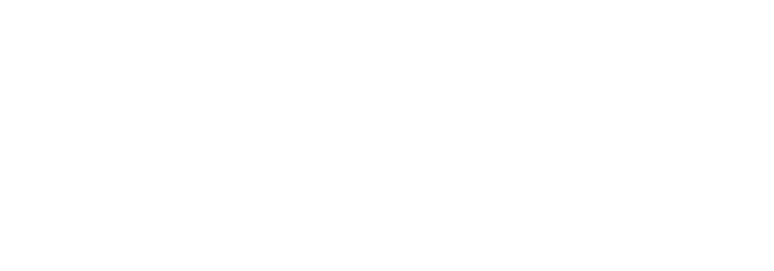Ergebnisse
Bohrkernuntersuchungen
In Kooperation mit dem Geographischen Institut der Universität Marburg, später der Universität zu Köln wurden unter der Leitung von Daniel Kelterbaum (Arbeitsgruppe Geoarchäologie, Küstenmorphologie und Geochronologie von Helmut Brückner) in mehreren Kampagnen mehr als 60 Rammbohrkerne bis zu 15 Metern tief abgeteuft. Anhand der Profile werden Bodenanalyse vorgenommen, Makroreste der Fauna und Flora untersucht und Radiokohlenstoffdatierung vorgenommen. Die ausgewählten Untersuchungspunkte und -strecken sind so angelegt, dass ein verlässliches Bild der Entwicklung vom einstigen Archipel zur heutigen Halbinsel nachgezeichnet werden kann. Somit lässt sich nun die wechselhafte Geschichte der Küstenverläufe während des Holozäns und damit auch für die Zeit um 600 v. Chr. in groben Zügen rekonstruieren. Demnach existierte Zur Zeit der griechischen Kolonisation neben der noch heute existierenden Straße von Kerč eine zweite östliche Durchfahrt, die wir zur Abgrenzung vom bestehenden Bild des Kimmerischen Bosporos mit einem modernen Begriff als „Kuban Bosporos“ bezeichnen.
Keramik
Mittlerweile liegen erste Ergebnisse zur Herkunftsbestimmung der aufgedeckten Keramik vor. Demnach fand während der frühesten Kolonisationsphase besonders viel Feinkeramik aus dem kleinasiatischen Keramikzentrum Teos seinen Weg in die Siedlung Golubickaja 2. Neben dem Herkunftszentrum TeosB (Mommsen, Labor Bonn) sind weitere nordionische Keramikimporte aus Chios und Klazomenai angetroffen worden. Darüber hinaus zeigt sich bereits ein sehr überraschendes Ergebnis zur lokalen handgefertigten grautonigen Keramik, der sog. Lepnaia-Keramik. Sie scheint nämlich entgegen der bestehenden Forschungsmeinung nicht nur lokal benutzt worden zu sein, sondern weist bereits deutlich auf ein regionales Handelsnetz hin, dass über die Taman'-Halbinsel und die Krim hinaus bis ans andere Ende des Asowschen Meeres ausstrahlt.
Kuban Bosporos
Nach den Voruntersuchungen zu Beginn des Projekts konzentrierten sich die Forschungen zunächst auf zwei Bereiche. Zum einen auf die Funde von Altgrabungen, zum anderen auf einige Fundstellen im vermeintlichen Hinterland: zwei befestigte Siedlungen auf der Nordseite der Taman'-Hablinsel am Azovschen Meer. Diese Siedlungen liegen an zwei strategischen Punkten beiderseits einer ehedem breiten Passage des östlichen Kuban Bosporos. In geomorphologischen Untersuchungen konnte nachgewiesen werden, dass sie schiffbar war. Diese Durchfahrt, einst nicht breiter als 2,5 Kilometer, gewährte zumindest die Ein- in das und Ausfahrt aus dem Asovschen Meer in den heutigen Liman von Achtanizovskaja. Dort lagen weitere Siedlungen an den Küsten und erhob sich das Heiligtum der Artemis Agroterea auf dem Vulkanberg 'Boris und Gleb' an der Spitze einer weit in den Liman vorgeschoben Landzunge. Diese wichtige Durchfahrt kontrollierten die beiden befestigten Siedlungen, deren antike Namen bisher nicht bekannt sind und die vorläufig nach einem Fundstellenbenennungssystem als Achtanizovskaja 4 an der West- und Golubickaja 2 an der Ostküste benannt sind.
Achtanizovskaja 4
Achtanizovskaja 4 wird in Kooperation mit Georgij Lomtadze vom Staatlichen Historischen Museum in Moskau erforscht. Anhand der Funde aus seinen Grabungen konnte der Nachweis erbracht werden, dass die Siedlung seit dem frühen 6. Jahrhundert v. Chr. durchgehend besiedelt war
Golubickaja 2, eine Neudatierung
Golubickaja 2 wurde zeitgleich mit Achtanizovskaja 4 an der gegenüber liegenden Küste auf einer kleinen Insel (die den modernen Namen Golubickaja-Insel erhielt) angelegt. Dies wird nicht nur aufgrund des gleichen Alters der Keramikfunde bestätigt, es wurden sogar die gleichen Gattungen wie in Achtanizovskaja 4 gefunden.
Seit dem Sommer 2007 finden hier reguläre Grabungen statt. Die Funde aus den Grabungen wie aus den Oberflächenbegehungen zeigen für die Besiedlung von Golubickaja 2 einen Zeitrahmen vom zweiten Viertel des 6. Jahrhundert v. Chr. bis zur Mitte des 1. Jahrhundert n. Chr. an. Es fanden sich bisher noch keine jüngeren Besiedlungsspuren und auch nach dem 1. Jahrhundert n. Chr. lässt sich keine Siedlungskontinuität nachweisen. Erst für die byzantinische Phase lassen sich in der Nähe der antiken Siedlung wieder kurzzeitige Aktivitäten feststellen.
Eine der wichtigsten Erkenntnisse stellt die Aufdeckung einer bereits in der Magnometrie als ca. 7 Meter breite Anomalie festgestellte Verteidigungsanlage dar. Mit den regulären Grabungen konnte ein mehrphasiges, in der letzten Phase über 20 Meter breites Verteidigungswerk aufgedeckt werden, deren Graben allein eine Breite von 10 Metern und eine Tiefe vom heutigen Niveau von 3 Metern aufweist. Der innen liegende Wall war in den 1960er-Jahren für die intensive landwirtschaftliche Nutzung mit Bulldozern abgetragen worden und nur noch in seinem Wallfuß nachzuweisen. Dagegen ließen sich die Phasen des Verteidigungsgrabens durch viele Funde chronologisch verlässlich nachweisen. Die erste Anlage kann wohl ins zweite Drittel des 6. Jahrhunderts v. Chr. datiert werden. Damit sind Anlage und Siedlung wesentlich älter, als bisher angenommen. Verteidigungsanlagen am Kimmerischen Bosporos wurden vor dem 5. Jahrhundert v. Chr. nicht für möglich gehalten.
Downloads
Beispiel für topographische Pläne V (pdf) Beispiel für topographische Pläne, erstellt von Studierenden aus dem Studiengang für Konservierung und Restaurierung/Grabungstechnik Hochschule für Technik und Wirtschaft in Berlin: Topographische Aufnahme des Gebietes um Altgrabung aus den 60er Jahren des 20. Jahrhunderts in Za Rodinu. Rekonstruktion der alten Grabungsschnitte mithilfe von alten Plänen, Fotos, neuer Vermessung, Luftaufnahmen und differenzial GPS-Vermessung (A. Kai-Browne, Ja. Orrin, Jo. Orrin, B. Lischewsky).
Beispiel für topographische Pläne III (pdf) Beispiel für topographische Pläne, erstellt von Studierenden aus dem Studiengang für Konservierung und Restaurierung/Grabungstechnik Hochschule für Technik und Wirtschaft in Berlin: leicht überhöhtes Modell des Schlammvulkans Boris und Gleb basierend auf der Vermessung der Jahre 2007/8 (M. Block, A. Buhlke, Ja. Orrin, Jo. Orrin).
Das in den Jahren 2007 bis 2010 untersuchte Grabungsareal 1 (pdf) Das in den Jahren 2007 bis 2010 untersuchte Grabungsareal 1 im Bereich der Verteidigungsanlage der griechischen Siedlung Golubickaja 2. Die Fortifikation bestand landseitig aus einer Graben-Wallanlage, die mehrere Phasen aufwies (A. Kai-Browne).
Beispiel geomagnetischer Prospektionen (pdf) Verschiedene Fundplätze, an denen bei Surveys archaische Keramik angetroffen wurde, sind zunächst geophysikalisch untersucht worden. Hier ein Beispiel von geomagnetischen Prospektionen. Des Weiteren wurden ausgewählte Bereiche auch mittels Geoelektrik und Georadar überprüft (H. Stümpel, Ch. Klein).
Beispiel für topographische Pläne VI (pdf) Beispiel für topographische Pläne, erstellt von Studierenden für Technik und Wirtschaft in Berlin: Einfacher Plan von Za Rodinu mit genauer Lage der Altgrabungen (A. Kai-Browne, Ja. Orrin, Jo. Orrin, B. Lischewsky).
Die Grabungsareale in der griechischen Siedlung Golubickaja (pdf) Die Grabungsareale in der griechischen Siedlung Golubickaja 2 nach der Kampagne 2011 (A. Kai-Browne, Ja. Orrin, Jo. Orrin, B. Lischewsky).
eFB14-3 Schlotzhauer_Taman (pdf)
Beispiel für topographische Pläne IV (pdf) Beispiel für topographische Pläne, erstellt von Studierenden aus dem Studiengang für Konservierung und Restaurierung/Grabungstechnik Hochschule für Technik und Wirtschaft in Berlin: l Höhenlinienplan des Schlammvulkans Boris und Gleb mit integriertem Plan der geomagnetischen Prospektion an der Stelle der Altgrabungen der 50er Jahre des 20. Jahrhunderts an den Resten einer ehemaligen Kirche, die mit Spolien eines auf dem Berg erbauten antiken Heiligtums errichtet worden war (M. Block, A. Buhlke, Ja. Orrin, Jo. Orrin).
Topographische Karte der Siedlung Strelka mit integrierter geomagnetischer Prospektion (pdf) Die griechische Siedlung Strelka 2, die an der Westküste fast 60 Meter über dem »Kuban«-Bosporos lag. Topographische Karte mit integrierter geomagnetischer Prospektion und einem ersten Testschnitt in der Verteidigungsanlage mit Graben und Wall, der noch gut 5 m hoch ansteht (A. Kai-Browne, B. Lischewsky).