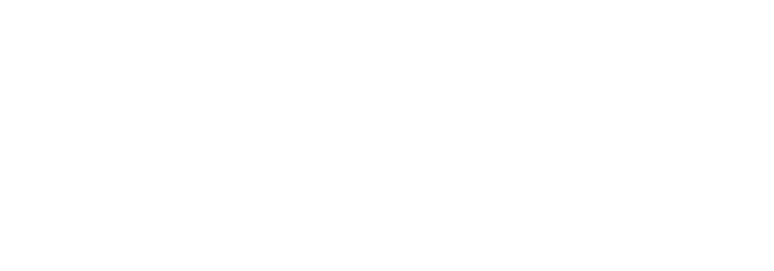Ergebnisse
Ergebnisse
1. Der Tempel des Antoninus Pius und der Faustina
Unweit der Ostseite der Basilica Aemilia befindet sich der Tempel des Antoninus Pius und der Faustina, dessen Benennung durch die Weihinschrift auf dem marmornen Architrav der Vorhalle gesichert ist (Abb. 1). Dessen ungewöhnliche Größe und exponierte Lage gegenüber der Regia und vor dem Eingang der Via Sacra in das zentrale Forumsareal werfen die berechtigte Frage auf, ob an dieser prominenten Stelle nicht schon ein Vorgängerbau stand. Indizien für diese Annahme liefern die Mauertechnik und das Material wie die in der Kirche San Lorenzo in Miranda verbaute Cella aus Peperinquadern, das Fundament aus Travertinplatten und die Plinthen aus Travertin unter der marmornen Säulenstellung des Pronaos. Allem Anschein nach gehören all diese Bauelemente zu einem entschieden älteren Bauwerk, das in den Neubau inkorporiert wurde. Erst bei seiner neuen Bestimmung als Kultstätte für das vergöttlichte Kaiserpaar wurde der Sakralbau mit einem neuen Pronaos aus Marmor aufgewertet, wobei auf den Plinthen des älteren Bauwerks nun größere Plinthen aus Marmor der neuen Säulenordnung aufgelegt wurden. Darüber hinaus wurden alle Wände des Podiums und der Cella bei der Erneuerung des Tempels in antoninischer Zeit mit Marmorplatten verkleidet, so dass sich das gesamte Bauwerk als ein vollständig neuer Tempel in Marmor präsentierte. Nach den topographischen Angaben von Ovid (trist. 3,1), Tacitus (ann. 15,41), Livius (1, 41,4) und Plinius d. Ä. (nat. 34,29) könnte es sich bei dem älteren Bauwerk um den Tempel des Iuppiter Stator handeln (Abb. 1.3).
2. Der ‚Tempel des Romulus‛
Das schräg hinter dem ‚Tempel des Romulus‛ ausgerichtete Bauwerk, in dem sich heute die Kirche der Heiligen Cosmas und Damianus befindet, gilt als die ‚Bibliotheken‛ des Templum Pacis, an dessen Rückseite der bekannte marmorne Stadtplan der Forma Urbis angebracht war (Abb. 2). Dieser Deutung widersprechen aber archäologische Zeugnisse und Überlieferungen antiker Autoren. Anzeichen dafür sind die Längsseiten des Bauwerks, deren Quader aus Aniene-Tuff in annähernd gleich hohen Lagen aufeinandergeschichtet, aber unterschiedlich lang und nicht im Wechsel von Bindern und Läufern angeordnet sind. Auf beiden Seiten befindet sich ein Eingang, dessen Leibungen aus Travertinquadern bestehen und über dem Türbogen aus Keilsteinen zusammengesetzt sind. Diese altertümliche Bauweise steht in scharfem Kontrast zu den Wänden des Templum Pacis, die samt und sonders aus Ziegelmauern bestehen. Nach der Mauertechnik und dem Material zu urteilen, insbesondere dem Tuff, sind die Längsseiten spätrepublikanisch, vermutlich in das späte 2. oder frühe 1. Jh. v. Chr., zu datieren und gehören damit einem entschieden älteren Bauwerk an als dem Templum Pacis aus flavischer Zeit. Weitere Indizien liefern die Angaben des spätantiken Historiographen Aurelius Victor (Caes. 40, 26), des ersten Buchs der Chronik (Chronogr. 354) und des Liber Pontificalis (I 279), nach denen es sich nicht um das Bauwerk der ‚Bibliotheken‛, sondern um das templum urbis Romae handelt. Dabei ist der ‚Tempel des Romulus‛ als Vorhalle dieses Sakralbaus zu interpretieren, die nach einem Brand von Maxentius erneuert wurde. Hinter der Cella des Gebäudes war das Tempelarchiv, an dessen Rückseite einst die berühmte Forma Urbis Romae angebracht war. Kein Bau in Rom eignete sich besser als Träger für den marmornen Stadtplan als dieser Kultbau. Wahrscheinlich standen in dem templum urbis Romae die Bildwerke der Penaten. Ein wichtiges Indiz dafür liefert die von Dionysius von Halikarnassos überlieferte Ortsangabe des Tempels der Penaten (Dion. Hal. 1,68,1-2). Dieser lag exakt in dem Bereich, in dem die Carinen in die Via Sacra münden und damit verbunden an das Forum Romanum angrenzen (Abb. 2.3). Bei den Carinen handelt es sich um den schmalen Weg, der vom Nordhang der Velia nach Süden zwischen dem ‚Tempel des Romulus‛ und der Maxentiusbasilika verläuft und dabei auf die Via Sacra trifft. Da in diesem Bereich kein anderer größerer Sakralbau liegt, kommt für die Lokalisierung des Penaten-Tempels nur das templum urbis Romae in Betracht. Allem Anschein nach wurde das heilige Areal beim Bau des Templum Pacis in flavischer Zeit zu einem großen zusammenhängenden Komplex ausgebaut, in dem der Tempel der Pax, das Tempelarchiv mit den Amtsräumen des praefectus urbi und der Tempel der Penaten vereint waren (Abb. 4). Letzteres Gebäude stand wohl bedacht in unmittelbarer Nachbarschaft zu dem Tempel des Iuppiter Stator, die beide zusammen auf die wichtigsten mythischen Ahnherrn Roms, Äneas und Romulus, verweisen.
3. Bedeutung der Kultbauten
Beide Tempel sind auch auf dem bekannten ‚Bautenrelief‛ des Hateriergrabes in Rom dargestellt (Abb. 5). Bei den Gebäuden handelt es sich um öffentliche Bauwerke im Zentrum von Rom, die in exakter topografischer Anordnung von Osten nach Westen aneinander gereiht sind. Am linken Bildrand befindet sich der Isistempel der Meteller, der im Bereich der heutigen Kirche S. Clemente stand. Es folgen das Kolosseum, das Heiligtum der Tellus im Bereich der Velia, das templum urbis Romae und schließlich der Tempel des Iuppiter Stator. An diesen Kultbau schließt am rechten Bildrand ein Bogen an, der als der Fornix Fabianus zu identifizieren ist (Abb. 3.4).
Die immense Bedeutung beider Kultbauten kommt auch in deren Nachnutzung zur Geltung. Beide Tempel wurden in der Spätantike in Kirchen umgebaut. An der Stelle des templum urbis Romae ließ der Papst Felix der IV. (526-530) die Basilika der Heiligen Cosmas und Damianus errichten (Abb. 2). Der altehrwürdige Tempel des Iuppiter Stator, der spätere Tempel des Antoninus Pius und der Faustina, wurde im 7. Jh. in die Kirche S. Lorenzo in Miranda umgebaut unter weitgehender Beibehaltung der antiken Bausubstanz (Abb. 1). Mit diesen Baumaßnahmen wollte man das Andenken an die loci celeberrimi bewahren und zugleich die neuen Kirchenbauten aufwerten.