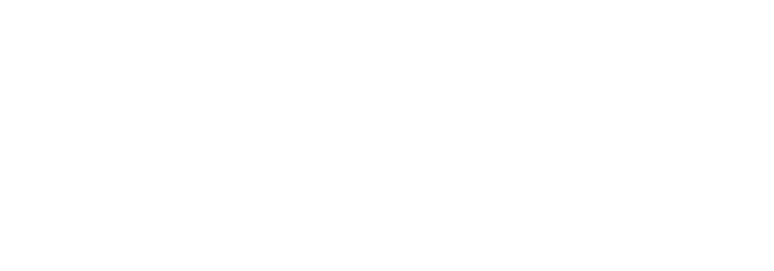Ergebnisse
Ergebnisse
Für die Rekonstruktion des ursprünglichen Zusammenhangs bietet zunächst der gekrümmte Block einen Ausgangspunkt. Aus der Krümmung lässt sich ein Kreis mit einem Durchmesser von ca. 13,80 m auf der Innenseite erschließen. Ferner ist an dem Block ein seitlicher Abschluss erhalten. In der Soffitte bezeichnet ein Dübelloch die Position, an der wohl mit Hilfe von Ketten Oscilla aufgehängt waren. Es handelt sich um die Dekoration einer Nische oder Exedra, denn die Rückseite des Gebälks blieb glatt, stand also ziemlich nahe vor einer Wand und bildete nicht das Innere einer Portikus. Ursprünglich war die Rückseite der hier betrachteten Säulenstellung mit Platten aus Stein überdeckt. Aus den vorhandenen Indizien muss man versuchen, die Länge des Blockes zu erschließen. Dabei ist davon auszugehen, dass ein Mehrfaches eines Blockes in dem Kreis aufgeht, ferner, dass die Ornamente vor allem der Soffitte symmetrisch angelegt sind. Die Indizien sind nicht eindeutig, so dass zwei Lösungen möglich bleiben.
Wie M.-T.Moroni beobachtet hat, stimmt der seitliche Abschluss des Blockes nicht mit dem Strahl eines Radius eines Kreises von 13,78 m überein. Vielmehr ist er schärfer angeschnitten. Dieser Schnitt kann kaum zufällig sein, denn die Bauteile wurden auf dem Baugrund vorgeformt und stimmen sonst bei solchen Konstruktionen immer mit dem Strahl des Radius überein. Vielmehr spricht diese Veränderung dafür, dass hier an der Front des Halbkreises der seitliche Schnitt zurückgesetzt wurde, um an dieser Stelle den Anschluss an die weiterhin gerade verlaufenden Gebälke der Front zu schaffen. Geht man von den vorhandenen Abweichungen aus, dann wurde die Linie des Halbkreises um ca. 30 cm zurückgesetzt, also um die Hälfte des Durchmessers des Gebälkes, das ja an dieser Stelle umbog. Allerdings passt an dem erhaltenen Block dazu nicht der Schnitt, denn bei Fassaden, an denen in eine durchlaufende Front eine halbrunde Nische eingelassen war, wird an dieser Stelle ein Diagonalschnitt verwendet, der im Zentrum rechtwinklig umbiegt. Dies ist an dem erhaltenen Block nicht der Fall. Vielmehr schloss ein Block an, der im rechten Winkel zur Front des Halbkreises nach vorne stieß.
Die Dekoration des Frieses geht bei dieser Größe auf. Der Durchmesser im Bereich des Frieses beträgt ca. 2 x 6,99 m, was für die Friesabrollung im Halbkreis eine Länge von 21,96 m ergibt. Die Länge einer Einheit aus Muschel-Gefäß beträgt 55 cm, was in dem genannten Maß genau 40 Mal aufgeht (Differenz 4 cm), während in demselben Abstand 10 Greifenpaare Platz hätten. In diesem Fall darf nicht der reduzierte Halbkreis zugrunde gelegt werden, da an den Ecken jeweils die Anschlussstücke hinzukommen.
Geht man nun von einem derart reduziertem Halbkreis aus, muss man als nächsten Schritt die Länge der Grundlemente rekonstruieren. Die Länge eines Gebälkblockes erschließt sich, wenn man von der Einlassung für die Aufhängung des Oscillum ausgeht. Ein solcher Block hat eine Innenlänge von ca. 2,10 m. Bei dieser fügen sich genau zehn Elemente in den reduzierten Halbkreis ein. In diesem Fall stehen allerdings die Säulen darunter sehr eng.
Deshalb kommt als zweite Lösung auch eine Gliederung in Frage, nach der die Blöcke ca. 2,62 m lang sind. In diesem Fall hätten die Soffitten zwei Einlassungen enthalten, die untereinander mit ca. 50 cm in etwa gleichem Abstand standen. Entweder trugen sie zwei Oscilla oder eines, das an zwei Enden aufgehängt war.
Bei dem unsicheren Stand unserer Überlieferung ist es immer problematisch, dieses so erschlossene Architekturensemble mit einem Bau auf dem Marsfeld verbinden zu wollen. In Frage kommen vor allem Fassaden, denn zu einer Portikus eines Platzes kann es kaum gehört haben und für Apsiden von Tempeln fehlen entsprechende Analogien. Vielmehr passen solche Elemente etwa zu Fassaden von Nymphäen, wie sie in Rom für das Septizodium bezeugt sind. Die Durchmesser der halbrunden Nischen betragen dort ca. 11 m.
Unter den bekannten Bauten fügt sich eine Nische, wie sie hier rekonstruiert werden kann, perfekt in die Scaenae Frons des Theaters des Pompejus ein. Nach Aussage des Marmorplans besaßen sie einen Durchmesser von 14 m, entsprachen also genau dem hier erschlossenen Maß. Ferner stimmt die Zahl der Säulen genau überein. Vor allem aber zeigt der Grundriss der Bühnenfront eine Eigentümlichkeit, die aus dem erhaltenen Teil erschlossen wurde. Denn auf der einen Seite biegt das Halbrund der Nische in die Fassade um. Auf der anderen Seite aber stößt er nach vorne um eine weitere Säule vor. Dieser Abschnitt ist gerade und das Teil ist erhalten, so dass wir exakt die Position bestimmen können.
Die Proportionen des Aufbaus passen ebenfalls in Analogie zu anderen Theatern, etwa dem von Sabratha, ebenfalls gut zu dem Theater des Pompejus. Dennoch bleiben viele Details der Bühne, besonders auch im Zentrum der Anlage, unklar. Hier haben überdies die neueren von der Soprintendenza Archeologica Speciale di Roma initiierten Untersuchungen Probleme in den Dimensionierungen dieser mittleren Durchgänge aufzeigen können.
Die Gebälke lassen sich aus stilistischen Kriterien in die Zeit Domitians datieren. Das Pompejustheater wurde der Überlieferung bei Cassius Dio (66,24,2) folgend 80 n.Chr. zerstört und danach wiederhergestellt oder auch neu gestaltet. Zu dieser zeitlichen Einordnung würden die Gebälkteile, aber auch weitere bei den oben genannten Arbeiten der Soprintendenz gefundenen Stuckdekorationen aus dem Inneren des Zuschauerraums sehr gut passen.
Das Theater des Pompejus bildete einen der wichtigsten Austragungsorte der Ludi Capitolini, die von Domitian 86 n.Chr. mit großem Aufwand nach dem Vorbild östlicher Spiele neu initiiert wurden. Im Zusammenhang dieser Spiele wird man den Dekor verstehen müssen.